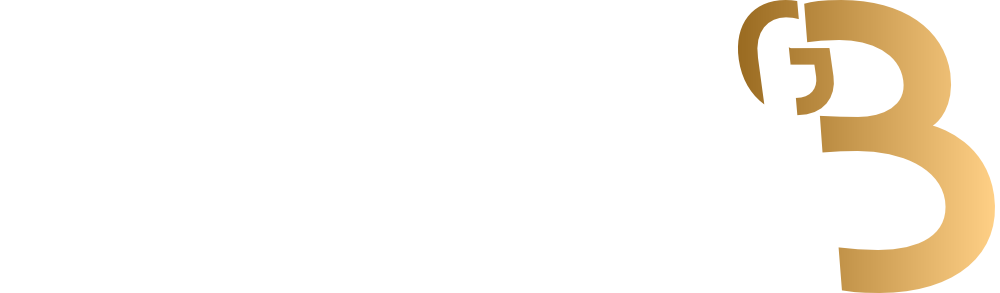Wie du das Führungs(entwicklungs)dilemma löst.
Was ist gute Führung?
Was braucht es für gute Führung?
Was brauchst du, um gut zu führen, und was brauchst du, um selbst gut geführt zu werden?
Gute Führung basiert auf Aufmerksamkeit, Bewusstsein, Disziplin und der Fähigkeit, sich um sich selbst und andere Menschen zu kümmern, sich und sie jeden Tag neu zu entdecken, Potenziale zu erkennen und für sich selbst sowie die Organisation nutzbar zu machen und das Zusammenwirken zu gestalten.
Allerdings scheitert sie zu häufig. Sie scheitert an den Erwartungen, die an sie gestellt werden. Sie scheitert, weil sie nicht den richtigen Raum hat. Sie scheitert daran, dass sie immer noch so ist, wie sie schon immer war.
Um gut zu werden, fehlt die bewusste Entscheidung, es anders zu machen. Um gut zu werden, muss man erkennen, dass gute Führung auf mehr basiert als auf Einfluss, Macht und zwischenmenschlichen Beziehungen, auf mehr als Strategien und Zielen, auf mehr als Entwicklungsplänen und Bewertungen.
Doch dem „anders machen“, dem „gut machen“, steht oft etwas Unterschwelliges, Unscheinbares und Übermächtiges im Weg: das System.
Führung lebt zu großen Teilen von menschlicher Interaktion. Das macht Führung so schwierig. Sich so auszudrücken, sich so auf andere einzulassen, die Perspektive zu wechseln, zu motivieren, zu bremsen, den Tellerrand zu überwinden, all das sind wichtige Bestandteile guter Führung – und all das ist für sich genommen schon enorm schwierig.
Will man also Führung verbessern, kann man bei den Menschen ansetzen. Allerdings braucht gute Führung auch gute Rahmenbedingungen. Ohne diese wird Führung zu einem Minenfeld unerreichbarer Erwartungen, Hoffnungen und Möglichkeiten.
In unseren Arbeitsorganisationen sind wir zu sehr gefangen in der Art und Weise, wie das Organisationssystem uns vermittelt, wie wir miteinander kommunizieren, welche Werte wir vertreten, wem und wie wir Respekt zollen, wen wir anerkennen oder ablehnen, welche Entscheidungen wir akzeptieren, wie und mit wem wir in den Dialog gehen, wessen Meinungen und Wissen zählen und wer sichtbar ist und wer nicht.
All dies bildet die feine und mächtige Grundlage von Zusammenarbeit und Führung. In deren Raum findet die Kommunikation und Interaktion statt, die wiederum das System bilden. Zugleich brauchen wir das System, weil es im besten Fall eine solide Basis bildet und es uns ermöglicht, unsere Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Sie sind essenziell, geben Stabilität und benötigen dennoch kontinuierliche Veränderungen.
Wir brauchen Systeme, die in den Organisationen Raum schaffen, um gut und zukunftsgerichtet zu führen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen wir die Systeme fortlaufend anpassen und verbessern. Wir müssen die alten Systeme hinterfragen und reflektieren. Wir müssen klären, ob die alten Regeln, Normen, Werte und Annahmen uns überhaupt noch ermöglichen, den Alltag optimal zu bewältigen, und ob sie es erlauben, in die Zukunft zu denken und entsprechend zu handeln.
Viele Systeme, die auf den Annahmen und Ideen des Organisationsdesigns vergangener Zeiten aufsetzen, sind heute dazu nicht mehr geeignet. Sie erfüllen bei weitem nicht mehr die Basisanforderungen an Effizienz und Effektivität. Unternehmen, die daran festhalten, verlieren so immer mehr an Wirkung. Sie wickeln sich langsam, aber sicher selbst ab.
Warum funktionieren klassische Ansätze nicht unbedingt?
- Führungsseminare und -trainings zur Bearbeitung individueller Kompetenzen.
Gesprächsführung, Feedback und Mitarbeitergespräche sind zwar das A und O guter Führungskommunikation, schaffen jedoch häufig nur punktuelle Verbesserungen – insbesondere, solange das zugrunde liegende System unverändert bleibt. Herrscht in einem Unternehmen etwa eine Kultur der Fehlervermeidung und Schuldzuweisung, hilft die getätigte Investition bestenfalls dem Unternehmen, in das die frustrierte Führungskraft wechselt. - New-Work-Ansätze setzen dagegen stärker auf Selbstorganisation und flache Hierarchien.
Einige Unternehmen haben beispielsweise klassische Abteilungsleiterpositionen abgeschafft und setzen auf Kreismodelle wie bei Holacracy oder Soziokratie. Das führt zu mehr Eigenverantwortung. Diese wird jedoch in dem Moment torpediert, in dem sich alte hierarchische Entscheidungsprozesse und Machtstrukturen wieder ihren Raum nehmen. - Kultur- und Wertearbeit, die versucht, Leitbilder zu schaffen, an denen sich Führung und Zusammenarbeit ausrichten können, ist toll und wichtig. Wenn sich diese neuen Normen und Werte aber nicht in Strukturen und Prozessen wiederfinden, wenn Entscheidungen nicht konsequent danach ausgerichtet werden und Fehltritte nicht geahndet werden, ist der Schaden hinterher größer als das Problem vorher.
Einzelne Experimente im Rahmen einer agilen Organisationsentwicklung sind hervorragende Ansätze, um Neues auszuprobieren. Sobald diese neuen Methoden jedoch auf klassische Budget- und Genehmigungsroutinen treffen, gerät die aufkeimende Hoffnung unter die Räder – und reißt oft weitere Innovationsansätze mit sich. Solange nicht alle Beteiligten die gleiche Intention verfolgen, können auch kleine Experimente ihre Wirkung nicht entfalten.
Das eigentliche Problem sind die offensichtlichen und unsichtbaren Elemente des Organisationssystems.
Solange die „unsichtbaren Spielregeln” nicht bewusst werden, bleibt jede Intervention erfolglos.
Dazu gehören etwa Fragen wie:
- Welche unausgesprochenen Normen prägen Entscheidungen („Der Chef spricht zuletzt“/„Fehler dürfen nicht sichtbar werden“)?
- Wie verteilen sich Macht und Einfluss tatsächlich (formale vs. informale Führung)?
- Welche Annäherungen an die Zukunft gibt es im Unternehmen (Innovationsräume vs. operative Zwänge)?
- Wo liegen die größten Widersprüche zwischen den offiziellen Regeln und den gelebten Praktiken?
Der Zusammenprall der im System hinterlegten Theorie mit der in der Organisation gelebten Praxis führt meist zwangsläufig zu Irritationen, Verzögerungen und oft auch zu ernsthaften Konflikten. Das Ziel einer systemischen Organisationsdiagnose ist es, das Unsichtbare, Nicht-Greifbare und kaum in Worte Fassbare so zu konkretisieren, dass darüber gesprochen werden kann, um ein neues Organisationsdesign zu entwickeln.
- Sie eröffnet einen ehrlichen Spiegel für alle Beteiligten.
- Sie macht die zugrunde liegenden Blockaden und Energiefresser sichtbar.
- Sie ermöglicht es, Ansatzpunkte für weitere Maßnahmen gezielt zu definieren, anstatt mit verstreuten Einzelmaßnahmen zu beginnen.
- Sie schafft einen gemeinsamen Ausgangspunkt, um Führung im System neu zu denken – und zwar nicht nur auf individueller Ebene.
Der erste Schritt zur Auflösung des Führungsentwicklungsdilemmas besteht also nicht darin, Einzelpersonen zu verbessern, sondern das System, in dem Führung stattfindet, zu verstehen und zu reflektieren. Eine strukturierte systemische Diagnose bildet die Grundlage dafür, im Anschluss passgenaue Maßnahmen (Trainings, Kulturarbeit, agile Modelle, Strukturanpassungen) wirksam einzusetzen.