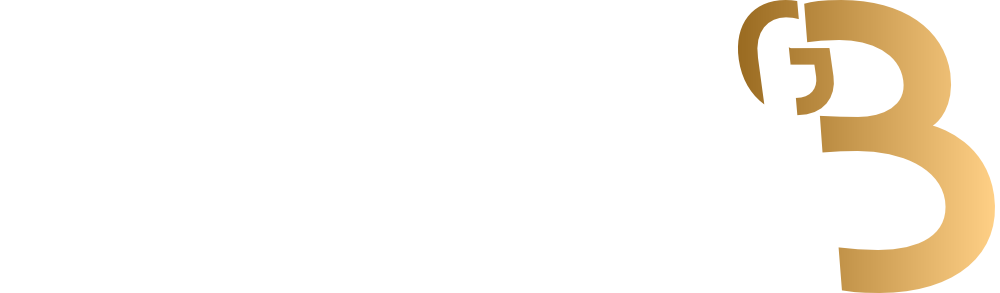13.08.19 | Blog, CoRE, Leadership / Führung, Management, Management Insights, Zusammenarbeit |
Gestern, am Ende des monatlichen AGILITYINSIGHT Webinars zum Thema „Der agile Paradigmenwechsel“ stellte eine Teilnehmerin uns teilnehmenden diagnostischen Mentoren, Lukas Michel, Günther Kopperger und mir, eine Frage auf, der ich noch ein bisschen rumkauen musste. Sie fragte ganz am Ende der Runde: „Was kostet Agilität?“.
Da wir drei immer wieder so tief in die Vorteilsargumentation einsteigen (müssen), brauchten wir einen kurzen Moment, um Antworten zu können. Natürlich ging es nicht um die Projektkosten für den Wandel oder die Zeit, sondern um die übrigen Dinge, die beim Wandel „auf der Strecke bleiben“. Anders ausgedrückt lautete die, wie ich finde, extrem spannende Frage: Welchen Kollateralschaden erzeugt Agilität?
Um es vorweg zu nahmen: Es sind nicht ‚üblichen Verdächtigen‘ Struktur, Sicherheit und Stabilität, die auf der Kostenseite stehen, wenn man an agile Arten der Zusammenarbeit etabliert. Einfach, weil „anders“ und „freier“ nicht bedeutet unstrukturiert zu sein, weil „gemeinsam“ und „selbstverantwortlich“ keine Synonyme für Unsicherheit sind und wohl nichts so sehr Stabilität verlangt, wie Agilität. Mein Beispiel ist hier immer ein Baum, der sich nur dann im Wind wiegen und beugen kann, wenn er fest verwurzelt steht. Ohne diesen Rahmen kippt er und schon ist alle Agilität und Flexibilität dahin.
Agilität zwischen Allheilmittel und Dünger
Agilität besitzt heute (zu) viele Aspekte einer Mode, fast bin ich geneigt hier auch Droge zu schreiben. So manch publizierte Ansatz liest sich wie ein Allheilmittel, das von der richtigen Person im richtigen Maß im Unternehmen vorgestellt und vorangebracht, für alle Bereiche und fast sofort geeignet ist, alle Probleme zu lösen. Einfach mal alle auf die neue Haltung einschwören, alles mögliche ausprobieren und schon kippt die Organisation von einem extrem (der Bürokratie) ins andere (der Adhocratie). Dass es dazwischen eine unglaubliche Zahl an Facetten gibt, dass jedes Unternehmen andere Anforderungen, andere Beteiligte und ein anderes Umfeld besitzt, scheint dabei als Basisinformation verloren gegangen zu sein.
In meiner Wahrnehmung ist Agilität eher ein Dünger, der es erlaubt die Dinge leichter, einfacher, schneller und zielgerichteter zu tun, allerdings nur, wenn er auf die Bodenbeschaffenheit (die Rahmenbedingungen) und die Pflanzen, die dort wachsen sollen, deren Bedarf an Nährstoffen (die Mitwirkenden, Strukturen, Prozesse und die Zielsetzung) abgestimmt ist. Nutzt man Dünger, der nicht zu den Gegebenheiten passt, so wachsen dort auch Pflanzen in einem Maß, die man dort nicht haben will.

Daher ist aus meiner Sicht einer der größten ‚Kostenfaktoren‘ die Bereitschaft und die Zeit, sich intensiv mit den Voraussetzungen und dem Status der Organisation auseinanderzusetzen. Das Umfeld zu betrachten, die daraus entsenden Anforderungen an die Organisation(seinheit), die Wege der Wertschöpfung zu analysieren und zu verstehen, das genutzte und das optimale (zukünftige) Managementmodell zu identifizieren, um dann zu entscheiden welche Ansätze und Modelle wann, von wem und wie, verändert werden sollten.
Diese Investition erfordert den Mut neue Perspektiven zuzulassen und sich auf neue Erfahrungen einzulassen, sie erfordert den Weitblick aktuelle und zukünftige Anforderungen zu erkennen, sie erfordert den Intellekt, sich mit den unterschiedlichen Modellen zu befassen, und die Empathie um diejenigen Ansätze zu erkennen, die für die eigene Orga funktionieren können. Es ist keine Aufgabe für ‚so nebenbei‘ oder eine, die (meiner Meinung nach) ‚nach unten‘ delegiert werden kann.
Dann erst, wenn dies alle bewusst und klar ist, kann man den Dünger (das geeignete Modell) und die Dosis und den Ort bestimmen, an denen man beginnt den Dünger einzubringen und damit die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit zu verändern.
Das bringt mich zum zweiten großen „Kostenblock“: Kommunikation. Wer eine Organisation verändern will, hat es mit Menschen zu tun, die, manche neugierig, andere misstrauisch, beobachten, was um sie herum passiert. Beginnt man agile Arbeitsweisen ein-, an- und umzusetzen, ohne zuvor das jeweilige Umfeld informiert zu haben, wird es schwierig, denn mit den Arbeitsweisen im Innern eines Teams oder eines Bereichs verändert sich auch deren Außenkommunikation an den Schnittstellen. Angefangen von Abhängigkeiten bei Entscheidungsprozessen bis hin zu der iterativen Entwicklungen der Ergebnisse muss allen, auch im Umfeld, klar sein, was, warum und wie „agil“ gearbeitet wird. Alles andere führt zu wachsendem Frust und Ablehnung auf allen Seiten.
Was noch auf der Strecke bleibt
Neben diesen beiden großen Punkten bin ich auf eine Menge „kleinerer“ Gewohnheiten und Denkmuster gekommen, die auf der Strecke bleiben, wenn in einer Organisation(seinheit) agiler und flexibler miteinander gearbeitet wird. Verabschieden muss man sich von Dingen wie strikt hierarchischen Entscheidungsprozessen, von Silodenken und jederzeitiger, direkter, (wieder) hierarchiebezogener Steuerungs- und Einflussmöglichkeit. Ebenso stehen Unklarheiten, „Need to know“ Kommunikation, „oben-unten“ Rollenverständnisse, und Beschäftigungsprozesse ohne signifikanten Einfluss auf die Wertschöpfung, z.B. in Form von diversen Reports für verschiedenste Gremien ohne inhaltlichen Zugewinn, auf der Verlustliste. Für manche kritisch mag es auch sein, wenn aufgrund flacherer Strukturen, die Aufstiegsmöglichkeiten wegbrechen und Entscheidungen auf anderen, ‚niedrigeren’ Stufen getroffen werden. Macht und Status sind ja schon lange in der Diskussion, können aber immerhin durch, auf besserer Zusammenarbeit basierende, Anerkennung und Reputation ersetzt werden.
Andere Prozesse und Strukturelemente stehen zwar nicht auf der ‚Abschussliste‘, werden aber an neue Positionen verschoben. Klassiker sind Controlling oder HR, die jetzt stärker in die agilen Strukturen eingebunden werden sollten. Ein ‚großes‘ Thema sind auch Planungsprozesse, die zwar größtenteils wegfallen, was aber, da gerade in großen Strukturen der Bedarf entsteht, sich noch intensiver mit den aktuellen und vorhersehbaren Entwicklungen zu befassen, kompensiert wird.
Daneben gibt es noch ein unglaubliche Zahl kleiner (und großer) Artefakte (also systembedingte Fehler), die die aus der Industrialisierung geerbten Strukturen und Modellen noch immer stark belasten und die Arbeit darin erschweren oder behindern, wobei z.B. der CoRE-Canvas dazu dienen kann diese aufzuzeigen und zu beseitigen.
Vieles von dem hier beschriebenen betrifft die Organisationsstruktur und Prozesse. In vielen Unternehmen hängt an diesen Strukturen und Prozessen jedoch das mittlere Management, die bisherigen Gralshüter bürokratischer und meritokratischer Managementmodelle. Hier laufen somit die größten persönlichen ‚Kostenpositionen’ auf. Für die Kollegen auf diesen Ebenen ändert sich am meisten, auch wenn mit einem neuen Zusammenarbeitsmodell deren oft vorhandene fachliche Kompetenz im Wert steigt. Doch neben der fachlichen Expertise sind in agileren Strukturen, mehr als bisher, die zwischenmenschlichen, sozialen Kompetenzen bei all jenen gefordert, die als Entwicklungsunterstützer und Kommunikatoren die entstehenden ‚Communities‘, ‚Kreise’ und Gruppen ‚bedienen’. Überlegungen und Lösungen für neue Führungsmodelle und -strukturen sind damit ein absolutes Muss im Wandlungsprozess.
Und neben all dem?
So, und spätestens jetzt schlägt bei mir das Orga-Begleiter-Herz durch, denn Ja, es entstehen auch Kosten für die Begleitung. Auch wenn es inzwischen viel Literatur zum Thema gibt, man zu jedem Modell alles Mögliche open source (und gerne auch geklaut) öffentlich findet: Menschen, die sich damit auskennen sind noch immer ihr Geld wert. Seien es Agile Coaches, um mit den Teams zu arbeiten oder Agile Supervisor, um auf der Management- und Führungsebene den Boden zu bereiten. Es hilft UND rechnet sich. Genauso, wie es sich rechnet, nicht einfach in das Thema zu starten, sondern die anfangs erwähnte Analyse bewusst und in einem sinnvollen Umfang durchzuführen. Alles andere kostet am Ende sonst das mehrfache.
Und, ja, dass ganze kostet Zeit. Der Logik eines agilen Miteinanders wurden zu viele von uns von Kindesbeinen an beraubt. So zusammenzuarbeiten ist tief in uns verankert, unsere Sozialisierung hat uns allerdings zu Opfern und Tätern (vor allem) der Bürokratie gemacht, was schwer ist hinter sich zu lassen.
Bleibt ein letzter wichtiger Punkt, den ich noch nicht betrachtet habe, nämlich die Frage: Welche Kosten entstehen, wenn man, obwohl es sinnvoll wäre, agile Arbeitsweisen NICHT zulässt oder einführt?
Auch eine Frage, auf der es lohnt herumzukauen. Aber da sind wir dann wieder mitten in der Vorteilsargumemtation und wer die noch nicht verstanden hat, ist gerne eingeladen, sich per PN oder mail bei mir zu melden.
P.S. (Edit 13.08. / 18:11) Weil es gerade so gut passt und aus aktuellem Anlass. Du bist Entscheider und fragst Dich ernsthaft, was Agilität bei Dir im Unternehmen bringen kann und soll? Du stellst Dir die Frage, ob Dein Unternehmen für ein dynamisches und komplexes Umfeld und die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt ist? Du möchtest herausfinden, ob die Zusammenarbeit im Unternehmen so komplikations- und reibungslos funktioniert, wie Du es brauchst?
Wenn Du testen möchtest, welche Potenziale der Agile Scan in Deinem Unternehmen identifiziert, dann nutze die ‚kleine‘ kostenfreie Demo-Variante, den „Free Agile Scan™“(Einfach bis zum Button „Zugang zum Free Agile Scan“ scrollen und das ‚Kleingedruckte‘ lesen). Das Dauerkopfnicken bei der Durchsprache des Reports garantiere ich.

07.08.19 | Blog, CoRE, Management, Management Insights |
Wenn einer eine Reise tut…. Dann schnappt er schonmal viele neue Eindrücke auf.
Wir waren die letzten Wochen in Südengland auf Tour. Zwischen Brexit, Stonehenge und dem Fastnet Race (einem der berühmtesten Segelregatten der Welt) gingen mir, wieder mal, ein paar Gedanken zur Zukunftsfähigkeit von Organisationen durch den Kopf.
In einem Land, in dem vor 4.500 Jahren Menschen zugleich kulturelle, wie auch technologische Höchstleitungen vollbracht haben, in dem vor über 800 Jahren mit der Magna Carta die Grundlage für noch heute als fortschrittlich wahrgenommene Landesverfassungen gelegt wurde, das zwischenzeitlich eine weltumspannende Größe entwickelt hatte, so dass die Sonne niemals unterging, das Traditionen nicht nur lebt, sondern sie zuweilen „atmet“ und das im Moment auf einen Schritt zusteuert, dessen Auswirkungen wohl niemand so recht vorauszusehen mag, habe ich mich unwillkürlich gefragt, wie es gelingen kann, sich eine Struktur und Form zu geben, die all das oder zumindest das, was auf einen positiven Ausgang hoffen lässt, ermöglicht. Aber Staaten haben, im Wortsinn, ihre eigenen Gesetze und Regeln. Selbst in Demokratien scheinen zuweilen Minderheiten den Ton anzugeben und Mehrheiten auszuhebeln. Darum denke ich lieber nur im (mir) vertrauteren Umfeld von Unternehmen.

Manche Unternehmen sind (dabei fast) ein Abbild eines alten Staates, wie ich ihn oben beschrieben habe. Sie basieren auf alten Leistungen, haben Größe erlangt, ihre ganz spezifischen Regeln, Rituale und Kulturen etabliert, Stolz entwickelt, Traditionen aufgebaut, und sehen sich jetzt, entgegen aller gemachter Erfahrungen, Entwicklungen gegenüber gestellt, die vieles in Frage stellen und zugleich wenig Klarheit erlauben. In den Unternehmen macht sich zunehmend Unruhe breit. Querdenker, Rebellen, Wahr(heit)sager versuchen (sich) Raum für Neues zu schaffen, während andere versuchen das Bestehende irgendwie zu sichern. Zwischen ‚früher war alles besser‘ und ‚die Anforderungen der Zukunft lassen sich nicht mit dem Denken der Vergangenheit meistern‘ tut sich ein Spalt auf, der die innere Bindungsfähigkeit von Organisationen an ihre Grenzen bringt.
Früher, früher war alles besser…..
In klassischen Organisationen lebt, mit dem darin tief verankerten meritokratischen Managementverständnis, ein Kompetenzmodell, das diesen bislang enorme Erfolge beschert hat. Wissen, Erfahrung, Information waren die Hebel, die, in der Logik des Systems, gute Führungskraft hervorbrachten und die Entscheidungen und Abläufe verbesserten.
David Marquet, vormals Kapitän eines US Atom-U-Bootes, hat am eigenen Leib erfahren, wie trügerisch es sein kann, wenn die Position definiert, wer Recht hat. Nachdem er sich über ein Jahr auf ein neues Kommando vorbereitet hatte, dann aber doch kurzfristig ein anderes U-Boot zugeteilt bekam, das an einigen entscheidenden Stellen ‚anders‘ funktionierte, gab er auf einer der ersten Fahrten einen Befehl, der sich so nicht ausführen lies – schlicht, weil es die Funktion für dieses Schiff nicht gab. Was im anderen Kontext richtig gewesen wäre, war hier nicht anwendbar. Schlimmer noch: Die Befehls- und Organisationsstruktur erlaubte es den Mitgliedern der Mannschaft nicht zu widersprechen. Das alte Kompetenzmodell war, in diesem Fall urplötzlich, an seine Grenzen gekommen.
Morgen wird (alles) anders.
Die Herausforderung, der sich Organisationen heute stellen müssen ist, die Vielfalt, das Durcheinander, die Unsicherheit alter und neuer Markt-, Wettbewerbs- und Umfeldstrukturen, die Multidimensionalität von Lösungen, Wissen, Informationen und, nicht zuletzt, Kulturen in sich aufzunehmen und geeignet abzubilden. Die eine, richtige Lösung gibt es weder als massentaugliches Produkt, noch als Organisationsform. Die Frage, die sich Organisationsgestalter daher heute stellen (sollten), ist:
- Welche Struktur passt zu uns UND zur Zukunft?
- Was denkt den bisherigen Bedarf von Kunden, Partnern und Mitarbeitern ab UND erlaubt zugleich sich an neue Anforderungen schnell und flexibel anzupassen?
- Was gibt Mitarbeitern Sicherheit UND Freiraum?
- Wie schafft man Stabilität UND Adaptionsfähigkeit?
Die wenigsten etablierten Organisationsmodelle beinhalten die dazu notwendigen Rahmenbedingungen in einem Maß, dass es erlaubt, sie 1:1 weiterzuführen. In fast allen Unternehmen stehen daher, oft zusätzlich und gleichzeitig zu markt- und kommunikationsbedingten Veränderungen im Kontext Digitalisierung und Agilität, Restrukturierungen an. Mehr und intensiver als diese in vielen Unternehmen ohnehin seit Jahren an der Tagesordnung stehen.
Die Kunst besteht darin, diese Schritte noch bewusster und noch größer zu machen, als bisher. Sie besteht darin, nicht nur agile Mini-Organisationen zu testen, sondern das Fundament so um- und auszugestalten, dass die jeweils passende Organisationsform für jede Einheit genutzt werden kann. So wie Scrum nicht die für jedes Team ultimativ richtige agile Arbeitshaltung ist, so wie jede Gruppe sich sukzessive und bewusst beobachtend dem annähern muss, was sich im Zusammenspiel als optimal herausstellt, so sollte eine Basisorganisation und eine organisationelle Basis aufgebaut werden, die Freiheit und Sicherheit vereinigt, die Stabilität und Anpassungsfähigkeit schafft und die auf die Anforderungen der Zukunft eingestellt ist.
Herauskommen wird in vielen Fällen (mindestens) eine bimodale Struktur, eine, die klassische Elemente genauso enthält wie progressive Netzwerkstrukturen. Eine die vieles zulässt und wenig einschränkt und in der dennoch oder gerade deshalb, optimale Zusammenarbeit möglich ist. Dies vor allem, weil den Beteiligten klar und bewusst ist, warum an welcher Stelle, welches Modell und welche Strukturform genutzt wird.
Um diese Basis zu schaffen braucht es viel Bewusstheit für die aktuellen Veränderungen Offenheit für neue Wege. Es braucht dabei vor allem die Beteiligung aller, die sich für die Zukunft des Unternehmens und ihres Arbeitsplatzes interessieren. Daher ist dieser Blogbeitrag nicht nur als Zustandsbeschreibung und Weckruf gedacht, sondern er ist auch als Hinweis (und Wunsch) an alle gerichtet, die irgendwo, in welchem Unternehmen auch immer, arbeiten. Wenn euch an eurer Arbeit liegt, bringt euch ein, wenn euch eure Arbeit stinkt, sprecht darüber, bringt euch ein und schafft so die Basis für Verbesserung. Neue, zukunftsfähige Organisationen zu gestalten ist mehr den je ein Gemeinschaftswerk!
Im CoRE Modell sind es 5 Themen, auf die der Fokus der Aufmerksamkeit gelenkt wird, um Organisationen zeitgemäß aufzustellen. Es handelt sich um ‚Strategie & Prozesse‘, ‚Beteiligung‘, ‚Struktur‘ und ‚Sicherheit’, die gemeinsam die Grundlage dafür bilden, dass gemeinsame ‚Wertschöpfung‘ auf einem neuen Niveau erzielt werden kann.
Daher meine Anregung, mein Impuls an euch: Geht mit offenen Augen durch eure Organisation und schaut in dieser 5 Fokusbereichen, was sich verbessern lässt, um optimale Zusammenarbeit zu gestalten. Denn um nichts mehr und nichts weniger geht es, wenn Organisationen sich für die Zukunft (neu) aufstellen. Erstes Ziel ist, alles aus dem Weg zu räumen, was gute Zusammenarbeit verhindert und dann mit neuem Wissen und neuen Erkenntnissen zielführendere Strukturen aufzubauen.
Mit Blick (zurück) in den Urlaub: Es war ein ganz besonderes Erlebnis beim Fastnet-Race die Hochseeyachten im Hafen und dann kurz nach dem Start zu beobachten, zu wissen, dass jedes einzelne Mitglied der Crews, ob an Bord oder an Land, darauf aus war, das Beste für das Team zu geben, zu sehen, wie die Boote wortwörtlich durchs Wasser flogen (Hydrofoils machen’s möglich und bedürfen zugleich eines anderen Bewegungsmusters und einer anderen Schwerpunktverteilung – einer anderen Organisation – an Bord) und dann (allerdings nur noch per app) mitzuverfolgen, wie die ersten beiden Mannschaften nach 608 Seemeilen (1126 km) etwas über 28 Stunden mit einem Abstand von nur 58 Sekunden ins Ziel kamen.
Zugleich war es ein Trauerspiel am Radio zu hören welche Ideen Boris Johnson für den Brexit propagierte und von britischen Freunden immer wieder zu hören, welche Befürchtungen sie für das weitere Wohl des Landes hegen und wie hilflos und jeden Einflusses beraubt sie dies mit ansehen müssen.
Ohne Frage: Wohl jeder, den ich kenne, wäre lieber Teil der Hochleistungsteams, die sich für den Erfolg einsetzen, als sich als Spielball einer Politik wahrzunehmen, die fern ab von jeder Einflussmöglichkeit der Logik vieler entzieht.
Wer Lust hat das Thema ‚Organisation‘ aus dieser und anderen Perspektiven zu reflektieren, ist herzlich eingeladen, an unserem freiKopfler-Webinar „Organisation frei denken“ am 22. August von 16:00 – 17:00 teilzunehmen.
Wer mehr zu CoRE erfahren möchte ist ebenso herzlich eingeladen, hier reinzuschnuppern.
Wer Begleitung und Beratung für die Entwicklung der eigenen Organisation sucht, ist ebenso eingeladen, sich zu melden.

31.07.19 | Blog, Leadership / Führung, Management |
>>> Impuls <<<
Keine Frage, für viele ist gerade Urlaubszeit. Wer kann, verlässt die heimischen Gefilde, um sich, fern ab vom heimischen und beruflichen Trubel, zu erholen. Für manche bedeutet dies Ruhe und Entspannung, für andere Abenteuer und Entdeckungen. Oft bedeutet es, sich mit anderen Menschen, anderen Kulturen, anderen Gepflogenheiten auseinanderzusetzen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die zunächst irritieren (wie hier im Süden Englands, wo wir an unserem Ferienhaus die Klinke der Haustür hochziehen müssen, um den Schlüssel drehen und die Türe abzuschließen zu können), manchmal sind es größere Dinge wie andere Sprachen, Speisen und Rituale.
Wir sind durch die Menschenbilder geprägt, die wir im Laufe unserer Entwicklung, im positiven, wie im negativen, kennengelernt haben. Wir sind Kinder unserer Erfahrungen und Entdeckungen, unserer Sozialisierung und Prägungen. Diese Bilder helfen uns, uns schnell zurechtzufinden und entspannen uns, wenn sie zu unserer Erwartung passen. Es entlastet unser Gehirn, wenn wir auf bekannte Muster treffen. Es irritiert, wenn ähnlich Muster anderes Verhalten erfordern, z.B. auf der linken Seite zu fahren.

Mein letzter Blogartikel „Disziplinarische Führung – alternativlos oder Auslaufmodell ?“ hat wohl ebenso erwartetes getroffen und neues aufgezeigt, wie er auch irritiert hat. Der Hinweis darauf, dass rein disziplinarische Führung (mindestens) in vielen Bereichen ein Auslaufmodell ist und das soziale Miteinander zunehmend in den Fokus rückt, hat viel Zustimmung geerntet, aber genauso wurde in Kommentaren darauf bestanden, dass Disziplin eingefordert werden muss, auf die ordnende Hand hier nicht verzichtet werden kann.
Die Kommentare, Likes und Shares zeigen: Jeder Jeck ist anders. Er zeigt aber auch: So manche wünschen dennoch, dass bitte alle so sind wie „wir“. Klare Struktur, klare Rangordnung, klare Weisungsbefugnis. Keine Abweichung von der Norm (okay, ich übertreibe wahrscheinlich gerade ein wenig, oder nicht?!).
Natürlich stellt sich in großen (und kleinen) Organisationen die Frage: Wie gehen wir mit den disziplinierten und den undisziplinierten um? Wen wollen und brauchen wir in der Orga, wer hilft die Ziele zu erreichen, wer stört? Wen sollten wir unterstützen, wen in seinem Tun beschränken. Kurz: Welche Führung brauchen wir?
Die klassische (und „kölsche“) Antwort darauf ist: „Ett kütt drupp ahn (Es kommt drauf an)!“ Und auch wenn man an „Ett hätt noch immer johlt jejange“ (Es ist noch immer gut gegangen) glauben könnte: die Zeiten ändern sich und Anpassungsfähigkeit und Vielfalt auszuhalten lohnt sich mehr denn je. Mit Blick auf die Vielfalt im Unternehmen bedeutet das, dass wir die Frage nach der Führung aus einer anderen Perspektive betrachten müssen: Was braucht das Unternehmen, damit die Menschen darin die Ziele bestmöglich erreichen können?
Und diese Antwort fällt dann vergleichsweise leicht. Die allermeisten Unternehmen brauchen die richtigen Menschen in den richtigen Rollen an den richtigen Stellen. Menschen, die sich in den Rollen, an den (Arbeits)stellen, zufrieden fühlen, sich wiederfinden und sich einbringen wollen. Sie brauchen den Rahmen, der zu ihnen passt, nicht den Rahmen, den anderen für sich (oder sie) in dieser Rolle, an dieser Stelle, für passend erachten. Sie brauchen (damit) Führung, die auf sie eingeht, die (auch wieder) individuell zu ihnen passt. Manche brauchen klare Aufgaben, andere nur die Idee eines Ergebnisses. Manche brauchen jemanden, der sie kontrolliert, um das Gefühl zu haben, das richtige getan zu haben, andere brauchen Feedback, dass ihnen sagt, ob sie noch in der halbwegs richtigen Richtung unterwegs sind. Manche brauchen eine Person, die sie führt, andere brauchen eine Gruppe. Ett iss halt jeder Jeck anders.
Die Gefahr ist, wie immer, wenn wir mit unseren eigenen, eindimensionalen Menschenbildern auf andere treffen, dass wir das eigene Menschenbild ins Zentrum unseres Führungsstils stellen, statt so zu führen, wie es die geführte Person braucht, um weiterhin zufrieden, gefordert, in Ruhe gelassen, im Gefühl der Sicherheit, dem der Weiterentwicklung, dem des Flows, dem der Herausforderung und Entspannung zu sein.
(Kern-)Führungsaufgabe ist, soviel Selbstaufgabe umzusetzen, dass die Unterstützung des Einzelnen und der Gruppe dazu führt, dass diese(r) optimale (zusammen) arbeiten können. Es bedeutet soviel Weg zu bereiten, dass die Menschen, um die es geht, diesen, mit all den Chancen, Beziehungen, Verbindungen, und Netzwerken, mit Klarheit und Sicherheit gehen können, ohne ihnen mit den eigenen Anforderungen und Erwartungen den Weg zu blockieren. Dazu muss man sich nicht verbiegen, es geht nicht darum, um jeden Preis zu dienen und alles zu tolerieren. Es geht darum, erwachsene Menschen als solche zu erkennen, zu behandeln und gemeinsam Großes zu erreichen. Es geht darum zu tolerieren, dass wir auf diesem Planeten über 7,5 Milliarden Individuen sind.
Es hilft dabei enorm sich selbst zu (er)kennen. Man sollte sich auf die Ideen, die Andersartigkeit, die Rituale, die Sprache, die Impulse einlassen können. Man sollte sie mit Neugierde beobachten, versuchen sie zu verstehen, sie ausprobieren. Man sollte führen, wie man eine neue Kultur kennenlernt. Vorsichtig hineintastend, beobachtend, hinterfragend, offen, einfühlsam und vor allem achtsam und bewusst. Dann kann auch Führung immer mehr zu einem Urlaub mit sicherer Entspannung und immer wieder neuen, positiven Erlebnissen werden.
17.07.19 | Blog, CoRE, Leadership / Führung, Management, Management Insights |
So manche Führungskraft, mit der ich zu tun habe, strahlt so richtig von innen heraus. Da weiß ich auch als externer, wow, hier klappt’s, hier passen Erwartungen, Aufgaben, Rollen, Rahmenbedingungen, Erfahrungen, Persönlichkeit und Umfeld zusammen. Hier entsteht regelmäßig mehr als jeder einzelne alleine zu vollbringen imstande wäre. Hier ist Hochleistung.
In anderen Fälle ist der Lichtschein aber auch nur ein Schimmern und kein Strahlen. Manchmal wird offensichtliches nicht gesehen und nicht getan. Manchmal ist es ein mühsames Glimmen und nur ein Fluchtpunkt, um die bittere Realität und die Selbstüberschätzung zu überdecken.
Keine Frage, als Führungskraft hat man es selten wirklich leicht. Gerade im mittleren Management in der berühmten Sandwichlage, müssen schon viele Parameter stimmen, damit der Job rundum glücklich macht. Und in der Zukunft, mit den vielen Entwicklungen in Richtung neuer Organisationsformen, neuen Anforderungen, neuem Leadership, immer schnelleren Veränderungszyklen, wird all das nicht besser. Dazu kommt die lange Liste an neuen Führungsstilen, die man doch bitte erlernen soll. Schließlich ist jeder Mitarbeiter anders, jedes Unternehmen hat andere Strukturen, bietet andere Voraussetzungen.
Alles in allem bleibt gute Führung vor allem eines: schwierig.
Was nach der perfekten Einleitung klingt, um endlich, den einen, den überragenden, den ultimativ besten Weg für neue Führung vorzustellen, wird jetzt etwas anderes. Mir geht es nicht darum vorzuschreiben, was und wie gute, zeitgemäße Führung ist. Ich will keine Verhaltensmuster vorgeben, die man dann einübt und auswendig lernt. Ich will „nur“ auf ein paar grundsätzliche Überlegungen hinweisen, die sowohl als Fokus- wie auch als Reflexionspunkte für jeden dienen können, der mit Führung zu tun hat – also tatsächlich für jeden der in einer Organisation arbeitet.
Diese Fokuspunkte stammen aus einem Konzept namens „CoRE“ = Collaboration Reframing & Evolution. Sie sind u.a. in einem Canvas strukturiert gegliedert und in 3 Cluster eingeteilt, die sich alle darum drehen, Zusammenarbeit leichter, besser, effizienten und effektiver zu machen und ihr dazu, im besten Sinne, einen neuen Rahmen zu geben.
Die drei Cluster gruppieren jeweils fünf Fokuspunkte und beziehen sich auf
- die soziale Interaktion
- das fachliche Miteinander
und
- den organisationalen Rahmen.
Aber bevor ich hier abschweife, steige ich besser einfach mal ein und ihr könnt ausprobieren, was bei euch anknüpfungsfähig ist.
Da es den Rahmen deutlich sprengen würde, hier alle 15 Elemente durchzugehen, starte ich hier mit den ersten fünf. Auf die anderen gehe ich in den nächsten Wochen in zwei weiteren Beiträgen hier an gleicher Stelle noch ein. Weil aber auch die ersten fünf schon viel Stoff beinhalten mein Rat: lest nur, was euch neugierig macht und Resonanz bei euch erzeugt.
Im ersten Cluster, der sozialen Interaktion, finden sich die 5 Fokuspunkte: Ziele, Beziehungen, Lernen, Autonomie und Wertschätzung
Im Kontext Führung bedeutet das jeweils sich mit folgenden Themen zu befassen:
Ziele
Ziele sind wichtig, weil sie Orientierung geben und damit handlungsleitend sind. Sie erleichtern, den gemeinsamen Weg zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Sie sollten daher klar kommuniziert, gemeinsam verstanden werden UND im Idealfall zu den Zielen der einzelnen Kollegen passen, d.h. es hilft ungemein, wenn es gelingt Anknüpfungspunkte zu identifizieren. Dazu muss natürlich erstmal bewusst sein, wer, welche persönlichen Ziele hat. Hilfreich sind daher regelmäßige Gespräche über die Ziele, wie viel schon erreicht wurde, was sich verändert hat, worauf man Stolz sein kann, welche Perspektiven sich eröffnen.
Probate Mittel um hier mehr Klarheit zu erhalten sind „Dailys“, also kurze (wirklich kurze!!) Abstimmungsrunden, in denen alle mit den anderen teilen, was sie gerade tun, was funktioniert hat, wo es Probleme gab und wo sie Unterstützung brauchen.
Wer einen großen Schritt weitergehen möchte, kann eine gemeinsame Zielelandkarte initiieren, in die jeder seine persönlichen, beruflichen, gemeinsamen Ziele eintragen kann und auf der man dann wie bei einer Mindmap, die Verbindungen und Gemeinsamkeiten entdeckt.
Beziehungen
Die Beziehungen untereinander müssen stimmen, sie sollten einen vorbehaltlosen Austausch über „alles mögliche“ erlauben und es aushalten, wenn man unterschiedliche Meinungen zum gleichen Thema hat. Denn gerade die Unterschiedlichkeit von Lösungsansätzen ist das Salz in der Suppe komplexer Aufgabenstellungen in dynamischen Umfeldern. Doch diese Beziehungen müssen aufgebaut und manchmal beendet werden. Für beides braucht es zielführende Vorgehensweisen und das Verständnis, das beides, auch die Trennung, dazu dienen kann, Raum für Weiterentwicklung zu schaffen. Gute Beziehungen sind essenziell und existenziell für gute Zusammenarbeit.
Gute Beziehungen leben vom gegenseitigen Interesse füreinander, davon die Erwartungen und Fähigkeiten zu (er)kennen. Helfen kann es dabei, bewusst Kontakte zu vermitteln, z.B. indem zufällige Begegnungen beim Mittagessen „verlost“ oder gleichzeitige Kaffeepausen teamübergreifend vereinbart werden. Wer den Kreis ausweiten will, kann sich auch für Hospitationen in anderen Organisationsbereichen einsetzen. Die Möglichkeiten sich besser kennenzulernen sind vielfältig.
Lernen
Wem es heutzutage nicht gelingt up to date zu bleiben, der fällt schnell zurück. Eine Binsenweisheit. Meist genügt es, sich in Bezug auf wenige spezielle Bereiche auf dem Laufenden zu halten, doch immer öfter haben diese Bereiche weniger mit dem rein fachspezifischen zu tun, als das bislang der Fall war. Zunehmend geht es auch darum, neue Arbeits- und Kommunikationstechniken auszuprobieren und zu erkennen, was tatsächlich geeignet erscheint. Dazu kommen immer neue Lernwege ins Spiel. Die klassische Schulung, das Fokusseminar wird immer mehr durch E-Learning Angebote ergänzt. Dazu trifft man sich auf neuen Plattformen physisch oder virtuell, man tauscht sich aus, man arbeitet auch hier mehr zusammen, nicht nur, weil es dann leichter fällt, sondern auch, weil diese „neue“, unvoreingenommene, funktionsübergreifende Zusammenarbeit insgesamt einen signifikanten Wandel durchläuft. Damit ist auch das Thema „zusammen, das richtige und wichtige für die Gruppe lernen“ eines, das Führungskräfte im Blick haben sollten. Ein Thema, das über die bekannten Teambuildingsworkshops weit hinaus geht. Aber damit kratze ich auch schon am Fokuspunkt „Beziehungen“.
Wenn ihr also gemeinsam mehr Lernen wollt, dann nutzt jede Gelegenheit. In Scrum werden regelmäßige Reviews und Retrospektiven genutzt, um sich über die Entwicklungen und Erfahrungen aus der Arbeit selbst (Reviews) und über die Formalien, wie den Prozess und die bestehenden Strukturen (Retros) auszutauschen. Solche Lernzeitinseln kann man genauso nutzen, um gemeinsame Rituale zu vereinbaren und sich über Erfahrungen jenseits des Organisationstellerrands zu unterhalten. Eine andere immer wieder wichtige Lernerfahrung ist als „kill your darlings“ bekannt. Dabei geht es darum Projekte, Produkt und Prozesse zu „beerdigen“, idealerweise in einer Form, die erlaubt die positiven und negativen Erfahrungen mitzunehmen und den Beteiligten für den geleisteten Einsatz zu danken. Gerne werden heute auch abteilungs- und bereichsübergreifende „Communities of practice“ aufgebaut, also Gruppen, die grundsätzlich das Gleiche tun, aber sich in der Organisation ggf. nie begegnen würden. Eine fast unerschöpfliche Quelle ganz wunderbarer Lernimpulse findet sich (natürlich) im Netz, z.B. bei den TED Talks. Einfach mal reinschauen, am besten gemeinsam und anschließend über das Gesehene sprechen.
Autonomie
Was jeder Vogel in einem großen Schwarm beherrscht und was immer mehr Autos „lernen“ ist, autonom zu handeln. Dabei geht es nicht darum, wie die Axt im Wald durchzusetzen, was persönlich wichtig erscheint, sondern, frei und zugleich mit den anderen abgestimmt, entsprechend der vereinbarten Regeln und Rahmenbedingungen und im gemeinsamen Interesse zu handeln. Vögeln gelingt es so, sich auch deutlich stärkeren Raubvögeln entgegenzustellen und Autos bringen auf diese Art Fahrgäste sicher an ihren Zielort. (Etwas, das um so leichter gelingt je weniger unkalkulierbaren Störquellen, aka Menschen, die die Regeln zu sehr beugen, man auf dem Weg begegnet….)
Autonomie in der Arbeitswelt hat noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Sie schafft (Selbst)Vertrauen und macht die Selbstwirksamkeit klar. Führt sie dazu, dass „die kleinen Dinge“ schneller entscheiden werden können, dass weniger Abstimmung notwendig ist, weil die Ziele (s.o.) klar sind und man weiß, wie der andere (re)agieren würde (siehe Beziehungen), wenn man vielleicht sogar weiß, wo und wie man neues lernen und gelerntes weitergeben kann.
Autonomie greift tief in die Entscheidungs- und Machtbefugnisse in der Organisation ein. Es ist also ein spannendes und spannungsreiches Feld. Sie hängt ganz eng mit dem Thema Geld bzw. Budget zusammen. Wer das Geld hat, hat nunmal auch heute oftmals noch die Macht.
Wer sich traut die alten Fesseln abzuwerfen, der kann zum Beispiel mit neuen Ausgabenlimits arbeiten, also die Beträge, die jeder einzelne „auf eigene Kappe“ ausgeben kann, auf eine sinnvolle Höhe bringen, s.d. man nicht mehr den Eindruck hat, zwar im privaten Autos und Häuser frei kaufen zu können, im Unternehmen aber bei jedem Bleistift nachfragen zu müssen. Auch Dezentralisation hilft Teams autonomer zu machen. Wenn nicht alles ständig „mit der Zentrale“ abgestimmt werden muss, fällt die Arbeit leichter, geht schneller und oftmals krönt auch noch mehr Erfolg den Mut.
Der wichtigste Aspekt ist aber sicherlich, Aufgaben und Rollen klarer miteinander zu vereinbaren. Vielleicht muss man nicht soweit gehen, wie das US-amerikanische Unternehmen „Morning Star“ in dem jeder mit seinen internen Lieferanten und Kunden einen „CLOU“ aushandelt, einen „Colleague Letter of Understanding“ indem die Erwartungen und Ziele im Detail abgestimmt werden. Meist reicht es, sich dessen einfach gemeinsam bewusst zu werden.
Ganz zentral im Kontext sozialer Interaktion ist, als letzter Fokuspunkt in diesem Blogbeitrag, die
Wertschätzung
Sie ist für viele der ausschlaggebende Punkt, wenn es darum geht „gerne“ und „mit vollem Einsatz“ etwas für andere zu tun – und sei es, für andere zu arbeiten. Sie bestätigt zugleich (Selbst-)Wirksamkeit und beflügelt unsere Motivation. Allerdings nutzt sich Wertschätzung auch ab. Wenn wir immer das gleiche „Danke“, das gleiche Gehalt, die gleiche erwartete Belohnung erhalten, dann nimmt deren Wert in unserer Wahrnehmung sukzessive ab und wird zur Normalität. Daher ist es wichtig immer wieder neu zu überlegen, wie Wertschätzung ausgedrückt und transportiert werden kann.
Gerade in Bereichen, in denen die kreativen und sozialen Fähigkeiten an Bedeutung gewinnen, etwa weil auf Kundenwünsche in ganz besonderer und individueller Art eingegangen werden soll oder neue Ideen eingebracht und weiterentwickelt werden sollen, kann Wertschätzung auch bedeuten, mehr Freiraum für eigene Impulse zu erhalten.
Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt in diesem Kontext, der jedoch erfordert konsequent und kontinuierlich daran zu arbeiten.
Der einfachste Weg Wertschätzung öffentlich und oft auch unerwartet zu äußern sind Kudo Cards und ein wenig Platz an einem (virtuellen) schwarzen Brett. Regelmäßige Treffen, in denen Peer-Feedback gegeben werden kann, sei es in 1:1 Runden, ist ebenso ein guter und leicht zu realisierender Weg. Wer weiter gehen kann und will gestaltet gemeinsame und „barrierefreie“ Veranstaltungen, bei denen man hierarchieübergreifend und ungezwungen über die sehr unterschiedlichen Sichtweisen der gemeinsamen Arbeit sprechen kann. Auch „ask me anything“ Townhall-Meetings können hier ein Punkt sein, um allgemein mehr Wahrnehmung, Sichtbarkeit und damit Wertschätzung zu vermitteln.
Das waren die ersten fünf Fokuspunkte, die es aus Sicht von CoRE lohnen betrachtet zu werden. Wenn ihr mehr zu CoRE erfahren sollt, dann schaut auf meiner website vorbei.
Wenn ihr das Thema „Führung“ einmal im Kontext der aktuellen Entwicklungen „frei gedacht“ hören und sehen wollt, dann könnt ihr euch noch zum entsprechenden freiKopfler webinar „Führung frei gedacht“ anmelden, das ich am 22.07. um 16:00 zusammen mit meinen freiKopfler Kollegen Heiko Bartlog und Christoph Karsten anbiete.
Wer noch tiefer einsteigen will: Wir veranstalten am 26. und 27. September in Berlin ein zweitägiges Seminar rund um „Führung, Karriere und Organisation frei denken.“ Anmeldungen sind natürlich schon möglich.
Für deine persönliche Entwicklung entsteht derzeit ein „CoRE.me“ Angebot, z.B. mit einer wöchentlichen mail, um jeweils ein Fokusthema zu betrachten und zu reflektieren. Hier könnt ihr euch dazu unverbindlich (an)melden.
Zu CoRE gibt es noch weitere Methoden, Modelle und Angebote, z.B. den Canvas etc. Mehr dazu, wie geschrieben, auf meiner website.

03.07.19 | Blog, Leadership / Führung, Management |
>>> Impuls & Perspektive <<<
Die Utopie einer schönen neuen (Arbeits-)Welt geistert ja immer mehr durch die Köpfe. Agilität, Kulturwandel, mehr Selbstverantwortung, Selbstorganisation, Demokratie im Unternehmen. Aus Sicht vieler gestandener Führungskräfte Horrorszenarien. Wie sollen denn diejenigen, die doch immer wieder nach Weisung fragen, die Entscheidungen benötigen, um die nächsten Schritte zu tun, die zu wenig die Politik des Unternehmens durchblicken, um selbst die richtige Richtung einzuschlagen, wie sollen all die, die doch offensichtlich mit dem Tagesgeschäft schon zu 120% ausgelastet sind, zusätzlich selbst noch mehr Aufgaben und Verantwortung übernehmen? Und wenn man es mal versucht, wenn man den Raum gibt, Dinge selbst zu entscheiden, ein Projekt einfach mal laufen zu lassen, dann dauert es oft nicht lange bis zum Stillstand, bis irgendjemand aufschreit, dass die Dinge massiv schieflaufen, weil Entscheidungsträger nicht eingebunden wurden, weil Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, weil das Ergebnis kaum mehr der Strategie des Unternehmens entspricht. Zeigt das nicht alles, dass diese ganzen gehypten Ansätze einfach nur für die Tonne sind, dass das alles nur schiefgehen kann?!
Die heute propagierten Führungsstile, wie transformationale, situative oder dienende Führung, um ein paar moderne Klassiker zu nennen, sind dabei noch gar nicht ‚das Problem’. Sie sind zwar bereits offener in der Führung, beziehen die Mitarbeiter stärker mit ein und drehen bereits teilweise das alte Verständnis von Führung aus einer hierarchischen Macht- und Statusposition heraus um, sind aber zugleich noch kompatibel zu den Fayolschen Dreiecksstrukturen, in denen Entscheidungen und Macht bewusst „oben“ allokiert sind. Führungskräfte haben hier weiterhin die lenkende, alles überblickende und verantwortende Rolle, die erlaubt zu fokussieren und zugleich diejenigen Mitarbeiter entlastet, die mehr Verantwortung als mehr (Di-)Stress wahrnehmen.
Führung – eine Reise?!
Diese Führungsstile sind eine Art Überdruckventil in einer Arbeitswelt, die sich schneller verändert als die heute üblichen Unternehmenssysteme, nach denen wir Arbeit tayloristisch in arbeitsteilige Prozesse, nach Fayol in hierarchische Strukturen, nach McKinsey mit Ressourcenbudgets und nach Gantt in überschaubar durchgeplante Abschnitte zerlegt und steuerbar gemacht haben. Sie versuchen zu kompensieren, was in der Logik älterer Führungsstile nicht möglich war, die Menschen stärker einzubeziehen, ihnen Entscheidungsraum zu geben und sie kreativ sein zu lassen.
Bereits dieser Schritt, der den Führungskräften im Wechsel von einer fachbezogenen zu einer nun menschenbezogenen Rolle oftmals viel persönliche Entwicklung abverlangt fällt vielfach schwer, zumal es an der Möglichkeit kompetenter Unterstützung im Führungsalltag, z.B. durch einen erfahrenen Sparringspartner oder Mentor, häufig mangelt.
Was aber, wenn die Reise weitergeht? Was, wenn die so gewonnene Geschwindigkeit in den unteren Abläufen nicht ausreicht, um auf die Dynamik im Markt zu reagieren? Was, wenn die bestehenden Strukturen (weiterhin) einen eher linearen Lösungsweg bevorzugen, statt heterogener Lösungsräume, wenn also versucht wird, komplexe Probleme kompliziert zu lösen – und der Kunde damit nicht das von ihm erwartete, tatsächlich auf seine Themenstellung passende Resultat erhält?
Wie muss dann die Organisation aussehen, wie kann und sollte Führung dann ‚funktionieren’?

Das Dilemma
Führung hatte immer die Aufgabe, die von der Organisation, dem ‚Management‘ vorgegebenen Rahmenbedingungen auszugestalten. In den aus der Industrialisierung geerbten Organisationssystemen bedeutete dies, die Zielvorgaben in die Organisation zu tragen und für deren Erreichung zu sorgen.
Heute, in Märkten, die immer weniger planbar sind, in denen Anpassungsfähigkeit bedeutsamer wird, in denen Teams Vielfalt, Hochleistung und Lösungskompetenz in sich vereinen sollen, in denen Selbstorganisation wichtiger wird, muss Führung damit eine neue Kernaufgabe erhalten. Es geht zwar immer noch darum, die gegebenen Rahmenbedingungen auszugestalten, aber diese Rahmenbedingungen wandeln sich inzwischen, nach fast 100 Jahren Stillstand, in einer zunehmenden Anzahl an Unternehmen. Wo die wichtigste Führungskompetenz „Mensch sein und sein lassen“ ist, wo es darum geht, in die Kollegen, Mitarbeiter, die Mitwirkenden und Beteiligten hineinzublicken, sie in ihrem Kern zu erkennen, sie überhaupt erst einmal davon zu überzeugen, diesen Kern sichtbar zu machen, statt eine Maske aufzuziehen, sobald der Unternehmensstandort betreten wird, da ist und wird es noch herausfordernder, Führung (vor) zu leben.
Menschen, die zeitgemäße Führung (vor)leben wollen, befinden sich heute in einem systematischen Systemdilemma. Sie sind auf der eine Seite gehalten, das alte System durch die Nutzung moderner Führungsstile zu unterstützen, auf der anderen Seite sollten sie sich aus Eigeninteresse und mit Blick auf die zukünftigen Notwendigkeiten in ihren Unternehmen darauf vorbereiten, die nächsten großen Schritte zu gehen und Führung dann (noch einmal) anders zu verstehen und zu leben.
In den Strukturen, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf uns zukommen, wird Führung sich breiter verteilen und anderen Paradigmen ‚gehorchen’. Wir werden beginnen, Führung (als strukturgebende Rolle) und Führung (als fachlichen Beitrag), jeweils basierend auf entsprechender Kompetenz, stärker zu unterscheiden. Wir werden die Rollen zu schätzen lernen und erkennen, wie viel an Erfahrung, Wissen, Einfühlungsvermögen und Reflexionsfähigkeit notwendig ist. Wir werden erkennen, dass Führung keine Frage des Alters und der Meriten mehr ist, sondern eine Frage von freiwilliger Akzeptanz und Reputation. Und wir werden erkennen, wie wichtig es ist, Führung strukturiert und in Strukturen zu leben. Denn jede Organisation braucht den für sie und den zu ihren Beteiligten passenden Rahmen. Ohne diese ist sie wie eine lose Blatt-Sammlung, die man vielleicht mal in einem Ordner findet, bei der aber niemand mehr weiß, in welcher Reihenfolge die Dinge Sinn ergeben.
Was passiert, wenn diese sehr unterschiedlichen Perspektiven von Führung in einem Unternehmen (auch sehr prominent) eingenommen werden, kann man gerade bei der Bundesagentur für Arbeit (wie passend) erleben.
Wer den Fall noch nicht kennt: einfach mal ansehen und über die möglichen Hintergründe und Abwehrmaßnahmen des Organisationssystems der BA nachdenken.
Apropos Nachdenken. Wir, die freiKopfler, wollen auch gemeinsam mit dir über Führung nachdenken. In unserem kostenfreien webinar „Führung frei gedacht!“ am Dienstag, 23.7.2019 um 16:00 laden wir dich ein, das Thema in größerer Tiefe zu reflektieren.
Wenn Du dabei sein möchtest, kann Du Dich hier schnell, einfach und kostenfrei anmelden: http://webinar2.freikopfler.de
An der Stelle auch ein Werbeblock für mein Kartenset „Führung“. Die wichtigsten, aktuellen Themenbereiche von zeitgemäßer Führung (Vertrauen, Kommunikation, Entscheidungen, Transparenz, Vernetzung, Abhängigkeiten, Beziehungen, Potenziale, Ziele, Werte, Feedback, Zusammenspiel) sind darin zur Selbstreflexion, mit Übungen (auch fürs Team) und Impulsen zusammengestellt. Hier gibt es mehr Infos.
18.06.19 | Blog, Management, Organisationsgestaltung, Zusammenarbeit |
>>> Perspektive
Ich gebe zu, ich gehöre zu den Menschen, die lieber einen guten Gebrauchtwagen – und den dann auch noch lange – fahren, als regelmäßig in einen Neuwagen zu investieren. Das hat viele Gründe, zum einen ist ein Auto für mich mehr Nutzgegenstand als Prestige, zum zweiten leben wir „auf dem Land“ und da ist es ohne Auto noch schwierig und drittens möchte ich die Dinge in Tiefe verstehen und Lösungen finden und ausprobieren können, d.h. ich schraube ich im Zweifel gerne auch selbst.
Bei uns in der Straße gibt es aber auch alle möglichen anderen Ansätze. Ein Nachbar fährt seine Autos bis sie regelrecht auseinanderfallen, andere haben ihre Firmenwagen und damit ohnehin alle drei Jahre etwas Neues vor der Tür und, ja, es gibt auch die klassischen Neuwagenkäufer. Sicher ist sicher, auch wenn’s etwas kostet.
Festzustellen ist dabei: Je höher und (vermeidlich) sicherer die Position (im Job), desto neuer und moderner, sicherer, wartungsärmer, einfacher zu bedienen und effizienter auch das Auto (inkl. der Firmenwagenfahrer).
Restaurierte Oldtimer
Ein Kollege aus meiner Konzernzeit hatte den netten Spleen, neue Produkte und Ideen in Analogien zu Autos zu präsentieren. Da gab es die Mercedes S-Klasse für die gehobene Ansprüche, den VW Golf fürs Volk und ein paar erste SUVs. So und damit bin ich bei meinem Punkt angekommen. Wenn ich in Unternehmen blicke, dann stehen da zwar die Neuwagen vor der Türe, in den Unternehmen wird aber konsequent auf Oldtimer gesetzt. Nein, ich meine nicht angegraute Manager, die auf Ihre Betriebsrente spekulieren. Es hat wenig mit dem Alter zu tun, NEUgierig und experimentierfreudig zu bleiben.
Was ich meine, sind die Systeme und Strukturen in denen wir arbeiten. An der Stelle nutzen wir Oldtimer aus den 20’er Jahren (ja, ich meine tatsächlich die 1920er Jahre). Die Ansätze wurden zwar alle 20 – 30 Jahre restauriert und bekamen neuen Lack, ihr Kern, ihr Antrieb, ihr Getriebe und das Armaturenbrett gehen dennoch auf die alten Managementtechnologien zurück. Meist sind wir uns dessen nicht einmal bewusst, sie werden ja zum Teil bis heute als „state of the art“ gelehrt, auch wenn Wissenschaft und eigene Erfahrungen dieser Lehre heute vehement widersprechen. Dazu kommt: Wer aus diesem Mainstream ausschert, wird kritisch beäugt, teils neidvoll, aber immer auch mit der Erwartung, dass in diesem neuen Konzept irgendwo ein Dieselgate schlummert. Die Angst davor wirtschaftlichen Schaden zu verursachen, indem in diesem grundlegenden Bereich etwas Neues ausprobiert wird führt zu wirtschaftlichen Schäden, die ich im Durchschnitt auf 25% bis 30% der Leistung der Unternehmen schätze.
Welche Folge diese (Fest)Haltung (am Alten) führt, hat Karl-Heinz Büschemann in seinem Artikel in der Süddeutschen am Freitag wunderbar auf den Punkt gebracht. In „Die große Verunsicherung der deutschen Manager“ schreibt er u.a. : „Die alten Gewissheiten der Unternehmensführung gelten nicht mehr. Die Lehrbücher helfen nicht mehr weiter. Stets wussten die Chefs wenigstens ungefähr, was passiert, wenn sie eine bestimmte Maßnahme ergreifen. Inzwischen berichten sie von dem Gefühl, den festen Boden unter den Füßen verloren zu haben.“
Das Grundbedürfnis „Sicherheit“ ist Angst und Ohnmacht gewichen. Lähmung ist die bittere Konsequenz.
Während in den Unternehmen die Manager langsam feststellen, dass das alte System nicht mehr zu funktionieren scheint, deutet sich meinem Analogon Autos ein Systemwechsel an. Dabei geht es mir nicht um Elektro- oder Brennstoffzellenantriebe statt Verbrennungsmotoren. Das ändern noch nicht wirklich das System. Was deutlich fundamentaler Wirkung zeigen wird, ist die Kombination aus der „sharing economy“ und autonom steuernden Fahrzeugen. Die logische Folge sind Mobilitätskonzepte, die den Besitz von Führerschein oder Autos größtenteils überflüssig machen und damit Industrien, Gesellschaft aber auch Bereiche wie Städtebau und Mobilität im Alter nachhaltig verändern werden.
Leadership and learning are indispensable to each other. (John F. Kennedy)
Der Abhang hinter dem Tipping Point
Wenn ich jetzt wieder das System „Organisation“ in den Blick nehme, so scheint hier der „Tipping Point“ eher erreicht zu werden. Nicht nur, dass viele Mitarbeiter die sie hemmenden Strukturen und Prozesse längst geschickt umgehen, sie betreiben auch sehr aktiv die Gestaltung der Zukunft – auch wenn sie sich alleine vieler strukturell-systemischer Altlasten nicht entledigen können. (Wie stark diese Bewegung ist, lässt sich an den Ergebnissen einer kleinen Studie von mir ablesen.)
Um ein Bild zu nutzen, das Gunter Dueck in seinem aktuellen Omnisophie Beitrag genutzt hat, beginnt die Kugel, die lange von den vielen, die es Sisyphus gleich tun und anderen “earyl Adapters“ neuer Arbeitswelten, mit viel Mühsal, Enttäuschungen, Entbehrungen, Niederlagen und dennoch mit viel Energie den Berg hinaufgeschoben wurde, nun langsam selbst den Berg auf der anderen Seite hinabzurollen und eine enorme Bewegungsenergie in sich aufzunehmen. Was lange nur Hirngespinst einiger weniger war, hat auf einmal das Zeug die (Arbeits)Lebensrealität vieler in großem Umfang und schnell zu verändern. Was bislang als „soft“ und „esoterisch“ abgetan wurde und gegenüber „harten Zahlen“ vernachlässigbarer „Kulturkram“ war, wird jetzt, mit Blick auf einen demographischen wie technologischen Wandel, der mit bislang unbekannter Dynamik, Komplexität und Geschwindigkeit die Unternehmensumwelten durchschüttelt, zur notwendigen Bedingung, um Zusammenarbeit in Unternehmen so effektiv zu machen, wie es die Zukunft ganz einfach erfordert.
Oder, um es anders zu sagen: Der Treibstoff für die bislang weit verbreiteten Oldtimer kann in naher Zukunft bestenfalls noch in Apotheken erworben werden und selbst dann ist er noch rar, teuer und schwer zu handhaben.
Die Arbeit nach alten Logiken hat ausgedient. Wir müssen das System dringend neu gestalten!
Die Kugel kommt ins Rollen. Das führt dazu, dass auch Menschen wie ich, die schon lange beobachten, wie teils verzweifelt versucht wird das alte System am Laufen zu halten und die gerade deshalb mit viel Energie die Kugel auf den Berg geschoben haben, erstaunt dastehen und gebannt zuschauen, wie sie sich auf der anderen Seite zur Lawine ausweitet und beginnt sich selbst den Weg zu bahnen.
Das Problem solch fundamentaler Systemveränderungen ist, dass es keinen wirksamen Abwehrmechanismus (mehr) gibt. Weder Aussitzen noch Wegducken, kein Ignorieren oder auf andere verweisen. Es gibt, wegen der Energie und der Ungewissheit, die eine solche Lawine in sich trägt, allein die Option auf ihr zu reiten, sie verstehen zu lernen, ihre Kraft zu nutzen, um dann (immer wieder) im richtigen Moment geeignet reagieren zu können. Der Wandel von einem durch wenige gesteuerten, plan- und kontrollierbaren Unternehmenssystem, hin zu einem, in dem optimale, breit aufgestellte Zusammenarbeit der einzige echte Garant für langfristige Existenz ist, lässt sich weder verhindern noch vermeiden. Die Lawine kommt und je länger man versucht vor ihr zu flüchten, desto mehr Momentum baut sie auf und desto vehementer ergreift sie die Flüchtigen.
Sie ist unaufhaltsam. Auch für diejenigen, die ihrem Oldtimer, dem alten Ansatz, bis heute zu 100% vertraut haben, auch wenn der Motor immer häufiger stotterte und einige Gänge im Getriebe nicht mehr funktionieren. Der Wagen fährt noch, er verliert an Geschwindigkeit, aber er fährt….. während die anderen über die Fahrt im Hyperloop nachdenken.
Andererseits, was weiß ich schon. Auch Lawinen sind nicht vorhersagbar und auch, wenn ich von der Bergspitze aus die Welt betrachte, es ist nur meine Perspektive auf die Dinge. Daher bin ich extrem gespannt auf eure Sicht und Ansätze, wie ihr mit der Lawine umgeht. Schreibt es bitte in die Kommentare und teilt den Artikel gerne, um aktiv weitere Sichtweisen einzubeziehen. Nie war der Dialog über diese Themen wichtiger als heute.
Ich freue mich übrigens schon auf die neuen Mobilitätskonzepte. Dann kann ich meine Lebenszeit sinnvoller einsetzen, als im Stau zu stehen. Dann kann ich auch im hohen Alter noch frei entscheiden, wann ich wohin fahren will. Dann kann ich alle Vorzüge genießen, die mit die heutige Technik einfach nicht bieten kann. Neu und anders ist dann in jedem Fall besser, als alt und gewohnt.
P.S. Wer das Thema aus der Perspektive „Digitalisierung“ vertiefen möchte. Gunter Dueck hat (auch dazu) hier einen lesens- und vor allem dringend reflexionswürdigen Beitrag geschrieben.