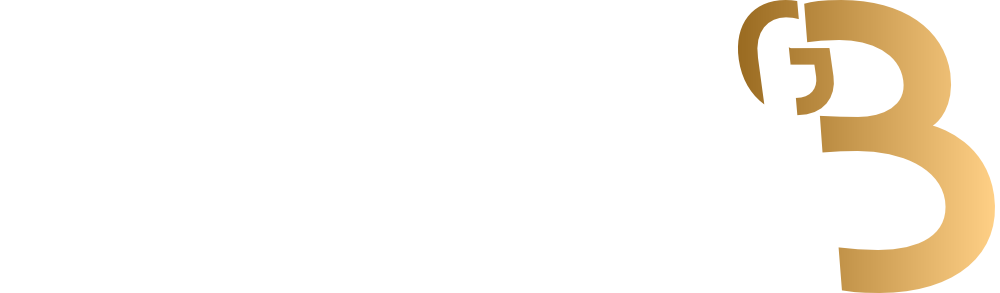27.03.19 | Blog, Leadership / Führung, Management, Organisationale Agilität, Wirksamkeit, Zusammenarbeit |
Warum wir uns unsere Zusammenarbeit einfach einfacher machen sollten.
Ein Denkanstoß
Wie man der gegenwärtig immer weiter zunehmenden Komplexität im Arbeitsalltag begegnen kann, ist immer wieder eine der Kernfragen bei der Umsetzung neuer Management- und Führungsmodelle. Folgt man dem Kybernetiker W.Ross Ashby, so muss man mindestens eine Stellgröße mehr in der Hand haben und nutzen können, als das System Freiheitsgrade besitzt, um es steuern zu können. In einer Umwelt, in der wir die Anzahl der Freiheitsgrade mit viel Glück abschätzen, aber sicherlich immer weniger wissen können, ist dieser regulierende Ansatz damit inzwischen kaum mehr nutzbar.
Ab-geregelte Kultur
Beim „nur“ Komplizierten war das anders. Kompliziertes kann man steuern, es sein denn, menschliches oder technisches Versagen führen zu unvorhergesehenen Einflüssen und Ergebnissen. Mit diesem schon früh erlangten Wissen haben wir mit unseren komplizierten Umfeldern etwas Interessantes gemacht. In der Wahrnehmung, dass wir ganz einfach steuern, kontrollieren und damit regelnd eingreifen konnten, haben wir diese mechanisierte Logik auf Geschäftsprozesse und den Umgang mit Mitarbeitern übertragen. Wir haben mit KPIs, mit Bürokratien, Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen Regelkreise in die Prozesslandschaft von vielen Organisationen implementiert, die suggerierten, alles jederzeit im Griff haben zu können. Mit allen Nebenwirkungen, die das auf die Kultur in Unternehmen hatte.
Im Fluss stehen und das Wasser aufhalten ist Schnee von gestern!
So schön diese Welt war – sie ist oftmals bereits Geschichte und in den Unternehmen, in denen sie noch nicht Geschichte ist, steht entweder ein Wettbewerber irgendwo auf diesem Globus bereit um Komplexität einzubringen oder das Angebot des Unternehmens ist ohnehin so wenig zukunftsfähig und attraktiv, dass sich niemand die Mühe macht, es anders oder besser zu machen.
Komplexität ist auf dem Vormarsch oder anders ausgedrückt: Das gefühlte Chaos ist Alltag geworden. Chaos, dass sich den alten Management- und Führungsideologien und -paradigmen entzieht, wie eine Fluß sich nicht durch jemanden aufhalten lässt, der in ihm steht und mit den Armen rudert.
Das Einfache im Komplexen wiederentdecken
Dennoch brauchen wir, um in Organisation miteinander halbwegs zielgerichtet arbeiten zu können, eine Idee, wie wir mit dieser Komplexität umgehen können.
Dazu wie Unternehmen sich aufstellen, um in ihrem singulären Fall damit umzugehen, gibt es ausreichend Beispiele. Alle involvieren das gesamte Unternehmen, also insbesondere alle, die daran mittel- oder unmittelbar beteiligt sind. Das Verständnis, wie man die Welle im Fluss reitet, wenn man sie schon nicht umleiten kann, zieht sich vom Top-Management bis hinunter auf den Shopfloor. White und Blue Collar workers, Kopf- und Handarbeiter, alle sind Teil eines anderen Umgangs mit der Herausforderungen und damit Teil eines anderen Umgangs mit sich selbst und mit den anderen Mitspielern. Das gemeinsame Verständnis ist dabei zumeist das einer Mannschaft, die gemeinsam, und jeder unter Einbringung seiner speziellen Fähigkeiten und Talente, ein Spiel meistern und idealerweise gewinnen will. Hier kämpft, fühlt, streitet und handelt man miteinander für den gemeinsamen Erfolg.
Dabei wählen diese Mannschaften oftmals eine Taktik, die es Ihnen erlaubt das Spiel zu gewinnen, die sie aber zugleich so wenig wie möglich fordert. Sie optimieren ihren Aufwand und Einsatz, indem sie ihre Reaktionen den Notwendigkeiten anpassen und sie zugleich optimal vereinfachen. Alle Aktionen gehorchen dem Muster: So komplex wie notwendig, so einfach wie möglich.
Ballast abwerfen
Diese maximale Vereinfachung ist dabei ein Prozess, der hohe Anforderungen an das Team stellt – wobei „Team“ hier für die Menschen steht, die den co-(re-)design Prozess der Organisation maßgeblich treiben wollen(!). Er erfordert Kompetenz und im besten Fall Meisterschaft in dem was getan werden soll, denn nur, wer sein Metier beherrscht, kann überschauen, was, wann, wie und wo tatsächlich notwendig ist und was weggelassen werden kann. So zu agieren erfordert eine gute Übersicht, vorausschauendes Handeln, einen bewussten Umgang mit Ressourcen und vor allem Mut zur Lücke. Es erfordert eine innere Einstellung, die es erlaubt loszulassen, neues, ungewohntes zuzulassen und sich auf das Einfache einzulassen.
Es ist der Moment, in dem vielen klar wird, das das eigene Wissen über die Auswirkungen und Abhängigkeiten nicht ausreicht und Dialoge notwendig sind, um sich und den übrigen Beteiligten den Blick auf das Gesamtbild zu eröffnen. Es ist der Moment, in dem Wertschöpfung plötzlich anders und neu verstanden werden kann, von Ballast befreit und ohne die Kehren und Wendungen, die vielen Abläufen und Strukturen aus ihrer jeweiligen Vergangenheit anhängen.
„maximal vereinfachen“ kann jeder
Wann habt ihr euch, bei dem was ihr vollbringt zuletzt gefragt, warum ihr genau so vorgeht, wie ihr vorgeht? Wann habt ihr zuletzt hinterfragt, ob ein Prozess tatsächlich nur so funktioniert oder ob es nicht doch einen einfacheren Weg gibt, zu ans Ziel zu kommen.
Mit diesen Fragen kann im Grunde jeder schon starten, für sich im Kleinen maximal zu vereinfachen.
„maximal vereinfachen“ braucht alle
Wenn es darum geht in ganzen Gruppen, Abteilungen, Bereichen oder Unternehmen die Strukturen, Prozesse, die Kommunikation, die Führungswege, kurz die Organisation radikal, maximal und optimal einfach zu gestalten, dann ist mehr gefragt. Dann geht es darum den Prozess gemeinsam zu wollen und vor allem vorbild- und beispielhaft „von oben“ zu initiieren.
Weg zu mehr innerer Stärke
Bewusste Reflexion ist dabei – wieder mal – das Schlüsselwort. Jeden Stein im Flussbett aufzuheben, zu betrachten, zu schauen, wie er andere Steine stützt, wie er die Strömung verändert, wie er eine neue, für den gewünschten Fluss/Flow bessere Position finden kann, ist eine Aufgabe, die viel Einfühlungsvermögen, Routine, den Blick für das große Ganze wie auch fürs Detail erfordert. Es ist etwas, das gemeinsam erlebt, erfahren und erlernt werden soll – idealerweise in Begleitung von Menschen, die mit unvoreingenommenem Blick, ohne Historie mit dem Prozess oder dem Unternehmen die Dinge hinterfragen und analysieren.
Es ist auch etwas, das immer anders aussieht, das immer einen anderen Fokus besitzt. Es gibt keinen vordefinierten Ansatz, wo diese neu gefundene Einfachheit beginnt. In manchen Organisationen ist es die Art wie kommuniziert wird oder Entscheidungen getroffen werden (wie bei Buurtzorg), in anderen, wie bilateral Zusammenarbeit abgestimmt wird (wie bei Morning Star), in anderen wiederum, wie Organisationsgrößen gefunden werden, s.d. jeder jeden kennt (wie bei W.L.Gore). Manchmal ist es radikale Transparenz und damit eine (in gewissem Sinne) vereinfachte Beziehungsebene (wie bei Bridgewater Investments) oder es ist die Vereinfachung der Führungskräfte(aus)wahl (wie bei Haufe umantis). Alle diese Beispiele sind erste Vereinfachungen in ganz speziellen, für das Unternehmen als wichtig erkannten Gebieten. Alle sind Ausgangspunkt signifikanter Verbesserungen in der Zusammenarbeit. Alle sind zugleich Felsen in der Brandung der äußeren Komplexität, die auf die Unternehmen einwirken und die Stabilität und Residenz erhöhen.
Beeindruckendes Zusammenwirken
Der Lohn für den Aufwand ist nicht nur die Aussicht auf eine einfach einfachere Zusammenarbeit, auf mehr Erfolg bei weniger Aufwand, auf Effektivität und Effizienz. Der Lohn ist auch, dass der Prozess die Menschen zusammenbringt, weil man sich gemeinsam Gedanken über etwas machen kann und muss, dass vielfach zur Routine, zum Alltag geworden ist. Der Weg zum Ziel birgt damit Etappenziele wie den Aufbau einer gemeinsame(re)n Identität, besserer Beziehungen, stabilere Netzwerke, schnellere Entscheidungswege, neue Rituale, eine gestärktes (Selbst)Vertrauen und/oder mehr wahrgenommene Sicherheit und Stabilität durch ein besseres Verständnis des Gesamtbildes. Es ist, was ich unter actawesome, unter beeindruckendem Zusammenwirken verstehe.
Einfach fünf erste Schritte
Wenn ihr euch aufmachen wollt, die Aufgabe anzugehen, wenn ihr „maximale Einfachheit“ und „optimale Vereinfachung“ sucht, dann sind die einfachsten ersten fünf Schritte zu denen ich euch rate:
- Klärt das „Warum“! Projiziert euch und eure Organisation für drei oder fünf Jahre in die Zukunft. Schaut und erkennt, was aus euch werden kann und werden soll.
- Betrachtet euren Startpunkt sehr genau. Identifiziert eure Potenziale, eure Ressourcen, die Hemmnisse und Störungen, die euch aktuell in eurem Tun hindern. Fragt euch, was davon weg kann.
- Legt die Richtung für den ersten Schritt zur Vereinfachung fest. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dieser erste Schritt nicht DER große Schritt sein wird, wird für euch auf der bevorstehenden Lernreise von besonderer Bedeutung sein.
- Fangt jetzt einfach sofort mit Schritt 1 an.
- Nutzt klassisch agile Instrumente wie Retros und Reviews, um euch immer wieder klarzumachen, woran ihr arbeitet, welche Schritte ihr gegangen seid, was ihr gelernt habt und neu dazulernen könnt und wie / wohin es weitergehen kann.
Ganz ehrlich – auch ich tue mich in meinem eigenen Bereich schwer mit maximaler Vereinfachung. Ich habe immer den Eindruck, das eine Perspektive fehlt, etwas zu kurz kommt, das noch etwas zu sagen bleibt. Daran stelle ich auch immer wieder fest, wie wichtig ein Referenzpunkt und unabhängiger, frei denkenden und handelnder Feedbackgeber ist. Jemand, auf den man sich in jedem Fall darauf verlassen kann und der die gemeinsame Zielsetzung teilt, Zusammenarbeit einfacher und damit besser zu machen.
Aber immerhin, den Splitter im Auge des anderen, kann auch ich besser sehen, analysieren, benennen und aufdecken… deutlich besser, als den klitzekleinen Balken in meinem eigenen Auge. 😉
21.03.19 | Blog, Leadership / Führung, Management, Nachhaltigkeit, Wirksamkeit |
Die zu oft vergessene Herausforderung für das Top-Management
Denkanstoß
Früher, als auch ich noch tief in klassischen Arbeitsstrukturen unterwegs war, bin ich desöfteren an der wahrgenommenen Untätigkeit ganzer Ketten von Führungskräften verzweifelt. Ich konnte es kaum aushalten, das Dinge die mir absolut logisch und wichtig erschienen nicht entschieden, nicht getan, nicht vorangebracht wurden. Immer wurde noch die eine oder anderer Schleife ´gedreht, es wurden Rückversicherungen vorgenommen, Befindlichkeiten abgefragt. Kurz: Voran ging gefühlt nichts.
Natürlich weiß ich heute, dass ich damals (schon) zu ungestüm war. Natürlich habe ich gelernt auf vieles mehr zu achten und meine Wahrnehmungen, gerade auch für Widerstände, zu verfeinern.
Dennoch, gerade in einer Welt vollen Transformationsdringlichkeiten, voller wichtiger und zeitkritischer Themen, gepaart mit einer zunehmenden Vielfalt „richtiger“ Lösungen, ist was mich früher verzweifeln ließ tatsächlich immer mehr ein Grund zur Beunruhigung.
Die Zahl wichtiger und dringender Entscheidungen wächst – die Wissens-, Erfahrungs- Erkenntnisbasis, auf der diese getroffen werden können, schrumpft zugleich.
„Zufriedenheit – Zuversicht – Zukunft“
Ende letzter Woche habe ich dazu spontan eine Umfrage mit dem Titel „Zufriedenheit – Zuversicht – Zukunft“ gestartet. Mich hat interessiert, wie die Menschen in den Unternehmen mit ihrem Wunsch, ihrer Sehnsucht, ihrer Ablehnung umgehen, den Wandel anzugehen. Es mag an der Zusammensetzung meiner Filterblase liegen (diesen Satz verbinde ich mit der eindringlichen Bitte die 4 Minuten in die Umfrage selbst zu investieren und sie möglichst breit zu teilen) oder daran, dass zunehmend in Unternehmen viel passiert, aber wenig davon nach außen dringt. Jedenfalls war ich neugierig.
Ein erstes, nicht repräsentatives Zwischenergebnis war dann auch für mich etwas überraschend: 60% der Teilnehmer sagten aus, dass sie den Wandel „gemeinsam mit anderen aber auch die Führung“ angehen würden. Noch interessanter ist dabei, dass zu diesem Zeitpunkt ca. 60% der Antworten von „Sandwich“-Führungskräften kamen, die nicht selbst zur Top-/Geschäftsführung gehören. Fazit: es gibt da einige, die sich dafür engagieren ihr Unternehmen zukunftsfähig zu machen! DANKE dafür! (Und danke für die Erkenntnis!)
Hohe Erwartungen an „die Führung“
Der Wunsch, die Sehnsucht nach Wandel ist (zumindest bei den bislang Befragten) groß. Die Zeichen der Zeit sind erkannt. Einzig, was fehlt, ist (teils) die echte, aktive, vorausblickende Beteiligung der Top-Mann- und Frauschaft.
Andererseits: Ich glaube, hier ist es Zeit für einen Perspektivwechsel und Gelegenheit eine Lanze für diese Top-Entscheider zu brechen.
Bis heute ist die Erwartung an die Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände etc. groß. Sie sind diejenigen, von denen Viele in ihrem Umfeld Richtung, Zuversicht, Sicherheit und Stabilität erwarten. Auch wenn das Umfeld dazu immer weniger Raum lässt. Ebenso groß ist auf dieser Ebene der eigene Erwartungsdruck an die Wahrnehmung dieser Verantwortung. Beides zusammen erzeugt – bezogen auf eine Zeit zunehmender Komplexität und Dynamik – einen immer weiter steigenden und inzwischen deutlich zu hohen Druck.
Ein Beitrag von Antoinette Weibel auf Linkedin hat mir diese Problematik nochmal deutlich vor Augen geführt. Es geht darin zunächst „nur“ um die Beschreibung von VUCA und resultierende Reaktionsmöglichkeiten. Eine Empfehlung sind Experimente, um mit Mehrdeutigkeit (Ambiguitäten) umzugehen.
Auch ich bin ja ein großer Verfechter von Experimente auf der Managementebene, um echtes „learning by doing“ zu ermöglichen. Doch, um Menschen, die ihre Tätigkeit in ihren Entscheidungs-FREI-Räumen und ihrer verfügbaren Zeit extrem eingeschränkt sind, komplett freiwillig und sehenden Auges in Experimente zu schicken, ist es absolut notwendig, dass sich diese zunächst mit der Themenstellung auseinandersetzen können. Sie müssen erst selbst erkennen können, welche Wahlmöglichkeiten sie haben, um dann „das richtige“ bzw. das für sie geeignetste Experiment zu starten.
Im Führerstand
Dazu fehlt ganz oft sowohl die Zeit, wie auch die Chance sich ausreichend und umfassend zu informieren. Wer kann sich schon die Vielzahl von Ansätzen, Konzepten, Chancen in Ruhe zu Gemüte führen, um dann aus der Vielzahl das geeignetste auszuwählen? Wer sich also nicht 100% von anderen, meist externen und damit per Definition unbeteiligten, Beratern abhängig machen will, wer sich den Überblick und die Chance auf Weit- und Einblicke erhalten will, der muss sich selbst mit den Dingen befassen. Aber wann und wie?
Egal wo man hinschaut: Alle, die richtungsweisend tätig sind, sind auch 100% Land-unter. Ob in KMU oder auf der HAL, BL oder Vorstandsebene in Konzernen. Der Alltag hat die Experimente abgehängt, bevor sie überhaupt aufgegleist werden konnten.
So mancher wird dabei von den Umständen getrieben, wie der Lokführer eines Zuges, der einen ihm unbekannten und extrem steilen Abhang hinabfährt. Die Wagons drücken, der Zug will immer schneller werden, aber ohne die Sicherheit die nächsten Kurven nehmen zu können, kann und darf der Lokführer die Geschwindigkeit nicht erhöhen. So sind die Reibungsverluste hoch, die Menschen in den Wagen spüren, dass es nicht richtig vorangeht und werden unzufrieden.
Die wenigsten Lokführer haben (sich) die Möglichkeit (eröffnet), mit einer Drohne die Strecke vorab in Augenschein zu nehmen, um sich vorzubereiten und so gezielt und abschnittsweise schneller voranzukommen. Die Übertragung des Bildes an die Passagiere im Zug hält diese zugleich auf dem Laufenden und schafft Raum, um ihre Energie sinnvoll einzusetzen, statt sie mit wenig gewinnbringender resignierender Aufregung zu vertun.
Noch als Science Fiction erscheint die Chance, das der Lokführer selbst im „Lufttaxi“ voraus fliegt, um aus neuen Perspektiven Weichen und neue Strecken zu finden, die für Teile des Zuges (oder den gesamten) geeignet sind. So ergibt sich irgendwann man die Chance den Zug aufzuteilen und so auf unterschiedlichen Wegen ans, ggf. auch veränderliche, Ziel zu kommen. Ein Vorgehen, welches es Netzwerkorganisationen wie etwa Haier heute schon zu gelingen scheint.
Vielleicht kommen wir in der Zukunft aber auch dahin, wie Doc Brown in „Zurück in die Zukunft III“ den gesamten Zug abheben zu lassen, und ihn – im ewigen Experiment – dahin zu lenken, wo es am meisten zu erleben und erledigen gibt.
Für lebenslanges Managementlernen fehlt der Rahmen
Doch etwas viel Realeres und Banaleres fehlt heute, wenn es darum geht den Zug zu führen: Eine geeignete Form der Wissensvermittlung, die die Ressourcenknappheit (vor allem Geld und Mut) der (Top-)Führungskräfte berücksichtigt. Wer auf Konferenzen oder Vorträge geht, kann sich zwar gut mit Gleichgesinnten vernetzen, die Inhalte, oft im 1:n (einer spricht vor vielen) Frontalformat präsentiert, sind aber naturgemäß themenspezifisch und damit selten konkret auf den eigenen „Case“ passend. Ähnliches gilt für Seminare oder Exec-MBA Programme, die immerhin erlauben die eigenen Fälle mit einzubringen. In Tiefe bearbeiten kann man sie dennoch (fast) nie.
Auch Unkonferenzen, wie Barcamps, und MOOCs bieten zwar Vernetzungsmöglichkeit und Themenvielfalt. Die Anwendbarkeit ist hier aber noch ungewisser, da die Themenauswahl zwar größer, die Möglichkeit zur Vertiefung aber meist noch weniger gegeben ist.
Es bleiben Newsletter, Podcasts, Bücher, Videos usw. die das Problem ebenso wenig lösen, da auch hier die Information nur selten punktgenau zur eigenen Herausforderung passt.
Was bleibt ist Beratung, Coaching oder Mentoring. Wobei – um auch kritisch mit dem eigenen Berufsstand umzugehen: Beratung nimmt das Wissen oft wieder mit und Coaching hilft auf der persönlichen Ebene, unterstützt aber nur selten beim Know-how-transfer von aktueller, fachlicher Management- und Führungskompetenz. So bleiben aus meiner Sicht Mentoren, fachlich kompetente und persönlich reflektierte Wegbegleiter, um mit den Führungskräften deren Themen an- und durchzugehen und zugleich ihr Wissen an die Mentees zu vermitteln. Nur in dieser Konstellation können Führungskräfte punktgenau und an den eigenen Themen das Fachwissen aufbauen, das sie benötigen, um anschließend mit (dann) kalkulierbarem Mut und Neugierde in ihre so wichtigen und zugleich teils riskanten Experimente zu starten.
Die Challenge
Eine Herausforderung bleibt: Den „richtigen“ Mentor zu finden, der sowohl persönlich passt, ausreichend Erfahrung mitbringt, fachlich aktuelles Wissen bereithält und dieses auch noch vermitteln kann. Mein Rat (und ich bin gespannt, wie ihr vorgeht, bzw. vorgehen würdet – bitte in die Kommentare schreiben): Geht auf die „Influencer“ und Multiplikatoren in euerem Netzwerk zu und fühlt ihnen auf den Zahn. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr beginnen könnt: startet bei den Top Voices, de Spitzenwritern, auf den „Bestenlisten“ der Themen, die ihr in euch aufsaugen wollt. Durchleitet euer Netzwerk und findet diejenigen, die wirklich etwas zu sagen haben. (Und: „ja“, ich biete das auch an). Ob ihr dann zunächst hochspezialisiert oder (wie ich finde zunächst erfolgsversprechender) thematisch sehr breit, um die Vielzahl der Möglichkeiten kennen zu lernen – folgt eurem Instinkt.
Es wird immer wichtiger, das richtige Wissen, zur richtigen Zeit verinnerlicht zu haben – unabhängig vom Wissen der Vielen und der Interaktion in der Gruppe. Nur wenn wer sich mit seinem Wissen wohlfühlt, bringt sich auch wirkungsvoll ein.
Dennoch ist gerade in exponierten Führungsrollen die Sicherheit wichtig auch „richtig“ zu liegen und mit dem „richtigen“ Gefühl grundlegende Entscheidungen zu treffen. Die Zuversicht, die es dazu braucht, muss auf der Erfahrung zuvor von innen heraus wachsen können. Denn alles andere ist hoch(un)professionelles Stochern im Nebel.
Vielleicht denkt ihr einfach mal darüber nach.
14.03.19 | Blog, Innovation, Leadership / Führung, Management |
Manche (er)leben es – andere verhindern sich selbst
PERSPEKTIVE
Deutschland lebt noch immer von seinem Mittelstand. Einer Spezies, die wahlweise als versteckt lebende Art (Hidden Champion) oder als auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Organismen/Organisationen wahrgenommen wird. Die einen scheinen alles richtigzumachen und die anderen an den einfachsten Veränderungstreibern und Transformationen zu scheitern. Den einen fliegt der Erfolg, fliegen die Innovationen zu, die anderen tun sich schwer damit das Fax abzuschaffen und stattdessen vermehrt auf e-mail zu setzen.
Die einen erreiche ich hier im Social Network, die anderen beim lokalen Unternehmerstammtisch – wobei ersteres, letzteres nicht ausschließt.
Dennoch wage ich es, letzteren, auch hier auf diesem Kanal, eine neue Perspektive aufzeigen zu wollen. Denn auch sie tragen das Potenzial in sich, in ihrer Einzigartigkeit zum echten Hidden Champion zu mutieren.
Keine Frage, jedes Unternehmen ist einzigartig, so einzigartig, die die Menschen und die Strukturen, die es prägen. So sehr sich manche Produkte ähneln, so sehr können wir als Kunden wahrnehmen, wie und worin sie sich für uns unterscheiden, welche Unternehmen unseren ausgesprochenen und unausgesprochenen Erwartungen entsprechen und welche sich schon beim ersten Kontakt disqualifizieren. Dabei ist das, was wir als Kunden wahrnehmen, die Exzellenz die wir manchmal erkennen, etwas rein subjektives. Es ist die Verschiedenheit, das Individuelle, das das Besondere ausmacht. Es ist, was Unternehmen zu Champions macht.
Diese Besonderheit zu transportieren gelingt dann am besten, wenn man viele Botschafter besitzt, die weitertragen können, was man alleine nicht kommunizieren kann. Wenn man Kunden und Mitarbeiter besitzt, denen ein Lächeln übers Gesicht huscht, wenn sie an das Unternehmen denken. Wenn man sich gerne identifiziert, sich mit der Idee infiziert. Wenn man sich freut den Kontakt aufzubauen und zu pflegen. Geschichten, Emotionen und Gefühle sind es, die den Wunsch wecken Distanz zu überwinden und Nähe aufzubauen. Es sind die Ingredienzien, die Menschen dazu bringt, sich gerne zu engagieren.
Doch wie gelingt das, wenn man doch schon mehr als genug damit zu tun hat seine Produkte und Kunden zu verwalten, wenn man liefert, was gewünscht wird, wenn man einfach nur macht, was jeder macht, weil die Zeit, das Geld, die Ressource auch so schon kaum reichen?
Um mit einem Opel Slogan zu sprechen: Das Umpacken beginnt im Kopf.
Ich habe bislang kein Unternehmen kennengelernt, dem es gelungen ist, die Potenziale, die in ihm stecken, wirklich vollständig und konsequent zu nutzen. Dabei sind es oft die kleinen Dinge, die der erste Schritt dazu sein können, sich selbst und damit das Unternehmen in einem neuen Licht zu erkennen.
Was ist was?
Es beginnt etwa damit, wie man „Potenzial“ versteht. Sind „Potenziale“ die bekannten Ressourcen, die es optimal einzusetzen gilt? Oder geht es um die unentdeckten Dinge, die in den Menschen und Maschinen stecken und für die die Zeit und oft das Interesse fehlte, sie zu entdecken?
Versteht man unter „Wertschätzung“ das Gehalt samt jährlichem Bonus, das „net geschimpft isch globt gnug“ oder die unerwartete besonderer Aufmerksamkeit, den Blumenstrauß, die Chance seine Idee auszuprobieren.
Ist „Mitarbeiternähe“ zu wissen was jemand für das Unternehmen tut oder zu erkennen, wie jemand denkt und was er fürs Unternehmen alles tun könnte?
Ist „co-creation“ die Einladung zur Produktvorstellung oder die Öffnung für Dialoge mit Kunden über deren Zukunft, Wünsche und Erwartungen?
Ist „Wettbewerb“ der Feind, den man bekämpfen muss oder die Chance gemeinsam die Welt aus den Angeln zu heben, weil man die gemeinsamen Themen schneller und breiter in den Markt tragen kann?
Wir scheitern an Objektivität
Wir versuchen immer wieder Dinge objektiv zu betrachten, um alles richtigzumachen. Richtig und Falsch bestimmen Entscheidungen, Prozesse und damit Organisationen. Wie wäre es auch „Richtig“ und „Falsch“ aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Als „subjektiv richtig“ und subjektiv falsch“, als persönliche Perspektive, als Teil individueller Geschichten und Erfahrungen?
Wem das auf der Ebene ganzer Organisationen (so klein oder groß sie sein mögen) gelingt, eröffnet sich die Chance das Mittelmaß zu überwinden. Der schafft Raum für individuell wahrgenommen Exzellenz, für das Besondere, für das was Kunden begeistert und Mitarbeiter dazu bringt, sich zu 100% mit dem (im positiven Sinn) gemeinsam geleisteten zu identifizieren.
Dieses Reframing ist es, was im Kopf beginnt und (vor allem) im Kopf des Unternehmens beginnen muss. Hier ist das neuronale Netz, das die Herausforderungen für das Unternehmen identifizieren, positionieren und annehmen kann. Hier ist der Bereich, der sich damit befassen kann, welche Stärken es zu stärken gilt. Hier sind die Menschen, die die Weichen stellen können, um gemeinsam mit allen anderen, die mit ihnen die Chancen erkennen, aus einem Allerweltsbetrieb eine Perle zu machen.
Es kommt am Ende zwar auf alle an, aber zuvor kommt es auf die wenigen an, die am Hebel dieser Weiche stehen.
Wieso ich darauf komme, dass die Potenziale in Unternehmen nicht genutzt werden? Es zeigt sich einfach immer wieder, wenn Weichensteller den Corporate Potential Calculatoroder das Agile Scan Angebot nutzen. Es zeigt sich schon, wenn sie nur die kleinste (und kostenfreie) Variante testen. Dann schon wird erkennbar, wo die Rahmenbedingungen zukunftsweisend bzw. wo sie, im Gegenteil, potenzialverhindernd sind.
Doch spätestens im Dialog, wenn auf die immer auch vorhandenen Stärken fokussiert wird, wenn Selbsterkenntnis ermöglicht wird, dann wird auch der Keim geweckt, um das Potenzial auch zu nutzen, dann eröffnen sich neue Möglichkeiten. Ein Prozess, der immer wieder Raum öffnet. Ein Prozess, der immer wieder begeistert. Ein Prozess der zeigt, dass in jedem Unternehmen ein Hidden Champion versteckt ist.

27.02.19 | Blog, Management, Management Insights, Zusammenarbeit |
Es kann durchaus sein, dass ich zu ungeduldig bin. Einen großen Teil meines Lebens warte ich nun schon darauf, dass sich die Art wie wir Unternehmen führen und Organisationen gestalten insoweit verbessert, als die darin steckenden Potenziale endlich und tatsächlich genutzt werden können. Ich bin selbst zu lange mit angezogenen Handbremse durch mein Berufsleben gefahren und genieße, bei allem Stress, den dies manchmal bedeutet, heute sehr, Gas geben und die Möglichkeiten bewusster ausschöpfen zu können. Klar, manchmal gelingt das auch in den heutigen Strukturen. Dennoch sind wollen oder können sich gut 80% in der aktuellen Strukturen nicht (mehr) engagieren.
Verschwendung im Billionenbereich
Aus der Sicht von Unternehmern ist dies eine unglaubliche Verschwendung. Verschwendung die sich, ganz nebenbei, auch beziffern lässt. Durchschnittlich nehme ich sie bislang bei 30% wahr, d.h. 30% der Potenziale werden nicht genutzt, 30% könnten mehr Wirkung erzielen, mehr Erfolg bringen, mehr Sicherheit, Wohlstand und Gewinn. (Wer genauere Zahlen für sein Unternehmen sucht, möge sich bei mir melden. *) ). Auf Basis des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) waren dies 2017 ca. 1,015 Billionen EURO. In Ziffern: 1.015.000.000.000 EUR.
Andererseits sind die Unternehmer/innen und die Top-Führungskräfte selbst oft Teil des Problems. Nein, sicherlich nicht absichtsvoll oder bewusst. Viel zu lange und viel zu oft haben wir alle gelernt und gehört, wie man Unternehmen nach den Maßstäben der Managementdoktrin der 50’er bis 90’er Jahre führt. Diese Maßstäbe haben viele (und auch mich zunächst) auf beiden Augen blind gemacht, wie ein grauer Star, der sich nach und nach im Auge ausbreitet und die Sehfähigkeit schließlich völlig nimmt. Doch diese Maßstäbe sind inzwischen ungeeignet für die Zeit in der wir leben und arbeiten. In den letzten 20 Jahren hat sich in der Welt außerhalb vieler Unternehmen zu viel verändert, um unbeschadet weiterhin nach den alten Mustern zu agieren.
Ums kurzzumachen: Ein Kursschwenk in Bezug auf die Art und Weise wie wir Unternehmen managen, wie wir den Rahmen für Zusammenarbeit gestalten tut dringend Not!
Leitgedanken zu zeitgemäßem Management
Um das Thema weiter zu befeuern, möchte ich ein paar Leitgedanken einbringen und damit (vielleicht auch) zur Diskussion anregen. Leitgedanken, beginnend mit Zielsetzungen, über die wichtigsten Prinzipien bis hin zu einem Manifest für zeitgemäßes Management. Und ich lade euch ein, diese hier mit mir zu diskutieren, um anschließend die Botschaft (hoffentlich) gemeinsam und auf einer breiten Basis, mit vielen Stimmen in die Unternehmen tragen zu können.
Um mit Simon Sinek zu sprechen: Let’s Start with why!
Zielsetzungen (und Hebel) zeitgemäßen Managements sind:
- die Wirkung und Wirksamkeit (aka Produktivität) der Organisation verbessern.
Als Hebel dazu dient, den Menschen Raum zu geben, um sich möglichst umfänglich einzubringen und an gemeinsamen Zielen arbeiten zu können.
- Vertrauen in die Organisation und die Menschen zu stärken, nach innen und nach außen.
Dabei hilft Transparenz, sowie die eigene und gemeinsame Klarheit zu Zielen, Erwartungen, Ansprüchen und Möglichkeiten. Ein Hebel auf diesem Weg ist es, den Rahmen zu gestalten, den jeder mit seinen individuellen Fähig- und Fertigkeiten zum gemeinsamen Wohl ausgestalten kann.
- Eine menschenfokussiere, raumgebende, zeitgemäße Führung.
Der Hebel den Organisationen (und deren Gestalter) in der Hand haben ist, Respekt, Toleranz und Diversität in den moralischen Grundsätzen zu verankern und diese (vor) zu leben. Zeitgemäße Führung agiert (selbst)reflektierend und (immer) weniger an formale Hierarchien gebunden.
- Gemeinsam immer besser zu werden.
Jede gewollte und überraschende Entwicklung kann als Gelegenheit zum Lernen begriffen werden, die einlädt gemeinsame und individuelle die Potenziale und Talente in immer neuen Umfeldern auszuprobieren und zu nutzen. Sich gegenseitig Wissen und neue Fähigkeiten zu vermitteln, Trends zu beurteilen, sie mit dem Wissen der Gemeinschaft zu evaluieren und die Öffnung für (teils befremdliche) Impulse und Inspirationen sind die Hebel, die hier viel bewirken können.
Wie kann das gehen?
Ein paar Prinzipen
Wo diese Zielsetzungen noch zu abstrakt sind, hilft es, sich ein paar grundlegende Prinzipien eines neuen zeitgemäßeren Managementansatzes bewusst zu machen. Es geht darum:
- die und den Menschen im Fokus zu halten, statt sich vornehmlich von Zahlen, Daten und Fakten leiten zu lassen.
- Die (Aus)Wirkung der Handlungen zu betrachten, statt zu erwarten, dass die Steuerung zu 100% funktioniert.
- Vertrauensvoll mit vertrauenswürdigen Menschen zu arbeiten, statt durch Druck auf alle die vertrauensunwürdigen zum Zaum halten zu wollen.
- Mit wachem Augen Chancen zu erkennen und zu nutzen, statt an Plänen festzuhalten.
- Ethik und Moral Raum zu geben, statt das eigene Wohl zu oft über das der anderen zu stellen.
- Arbeitsleistung und Wertbeitrag statt Arbeitszeit als Maßstab für den Beitrag zum gemeinsamen Ziel zu betrachten.
- Anpassungsfähigkeit und Kundennutzen, statt Vorgabenerfüllung zu belohnen.
- Potenziale und Talente zu erkennen und zu nutzen statt sie zu missachten und zu verschwenden.
- Zusammenarbeit statt Konkurrenzdenken zu fördern.
- Organisationsweite Interaktion zu unterstützen statt Abschottung und Silos zuzulassen.
- Gemeinschaft mit Eliten statt unerreichbarer Elfenbeintürme aufzubauen.
- Die Gesellschaft und das Gemeinwohl, als Basis unseres Zusammenlebens im Blick zu halten.
Was kann man tun?
Aus diesen Prinzipien leite ich einen handhabbarer Handlungsrahmen, ein Manifest für zeitgemäßes Management, ab:
„Management, sowohl als Institution wie auch als die dieser Institution Leben einhauchenden Menschen, hat die Aufgabe, in und für Organisationen Rahmenbedingungen zu formulieren und zu schaffen, die eine optimale Zusammenarbeit im Hinblick auf die Ziele der Organisation ermöglichen.
Management gibt damit den Raum und Rahmen für
- Engagement durch Selbstverantwortung,
- Koordination durch Selbstorganisation,
- Mobilisierung der Organisation durch Sinn,
- Veränderung auf Basis von neu erworbenen und bestehenden Fähigkeiten,
- Führung durch bewusst verteilte Verantwortung,
- Ausrichtung durch fokussierende und reflektierende Instrumente,
- Reflexions-Freiraum durch Routinen, Stabilität und Sicherheit,
- Vertrauen durch eine vertrauensvolle Basis und Konsequenz bei Vertrauensmissbrauch,
- Mentale Freiräume durch die Offenheit für neue und andere Denkweisen.
Selbstverantwortung ist die Grundlage für Motivation und Spitzenleistungen. Diese Kombination braucht gute (Selbst)Wahrnehmung, Raum für einen klaren Fokus der Aufmerksamkeit, Vertrauensfülle, gepaart mit Vertrauenswürdigkeit und Wahlfreiheit.
Selbstorganisation entsteht durch eine Kultur mit gemeinsamen Werten. Sie wird durch Führungskräfte unterstützt, die die Interaktion und den Dialog suchen. Führungssysteme (Regeln und Routinen) helfen, sich selber zu organisieren.
In weit gesteckten und zugleich die Energie der Gemeinschaft fokussierenden Zielen finden Menschen Sinn und Motivation. Sie können zusammenarbeiten (ohne Kompromisse bei ihren eigenen Zielen) und suchen nach Lösungen, die weit über ihre individuellen Möglichkeiten hinaus gehen.“
Wir wissen wohl alle, dass die Managementaufgabe keine mehr ist, die sich heute weiterhin vornehmlich der Planung und Steuerung widmen kann und darf. Es geht viel mehr darum, die Basis für die Zukunft des Unternehmens zu gestalten, die Verantwortungsräume zu öffnen und schnellere, anpassungsfähigere Strukturen zu schaffen, ohne das Ziel der Organisation dabei aus den Augen zu verlieren. Dieser Blick über den Tellerrand, die Wahrnehmung der äußeren Entwicklungen und das Herunterbrechen der Erkenntnisse auf die eigenen, sich ausweitenden Möglichkeiten und Bedürfnisse ist, was, aus meiner Sicht, Management in (Richtung) der Zukunft prägen wird.

Was heute in vielen Unternehmen geschieht, um den Komplexitäten und Dynamiken zu begegnen ist leider von einer ganz anderen Denke geprägt. Statt sich selbst mit den Themen zu befassen, wird das Experiment „neues Arbeiten“ in Richtung Mitarbeiter delegiert. Agile Teams werden aufgebaut, neue Substrukturen geschaffen, Inseln erzeugt, die zu oft und zu schnell feststellen, dass sie zwar schneller rennen sollen, damit aber zugleich die Verbindung zur Restorganisation verlieren. Sie beißen sich all zu häufig an Entscheidungsprozessen und Abhängigkeiten die Zähne aus, die für alte Organisationsmuster etabliert wurden und dort (vermeintlich gut) funktioniert haben. Im Ergebnis steigt nicht nur der Bedarf an interner Mediation und agilen Coaches, es machen sich in großem Umfang auch Frust und Demotivation breit. Die tiefgreifendsten Ergebnisse eines solchen Vorgehens sind die innere Abkehr von gescheiterten Versuch Zusammenarbeit wirksamer zu gestalten und ein (weiteres) Auseinanderbrechen der Organisation.
Der BeRater in mir:
 Beginnt beim (alten) Kopf des Fischs. Liebe Top-Manager, startet selbst damit die Parameter neuer Zusammenarbeit zu verstehen und zu leben. Startet mit einem (ggf.) neuen Verständnis für eure Aufgabe und geht dann erst die notwendigen Schritte, gemeinsam mit den übrigen Mitwirkenden in der Organisation, an **). Dreht den Spieß um und nehmt das Heft ganz bewusst selbst in die Hand. Es eröffnet euch die Chance die Organisation zielgerichtet in die Zukunft zu bewegen.
Beginnt beim (alten) Kopf des Fischs. Liebe Top-Manager, startet selbst damit die Parameter neuer Zusammenarbeit zu verstehen und zu leben. Startet mit einem (ggf.) neuen Verständnis für eure Aufgabe und geht dann erst die notwendigen Schritte, gemeinsam mit den übrigen Mitwirkenden in der Organisation, an **). Dreht den Spieß um und nehmt das Heft ganz bewusst selbst in die Hand. Es eröffnet euch die Chance die Organisation zielgerichtet in die Zukunft zu bewegen.
Nebenbei: Niemand kann von euch erwarten, dass ihr diese Aufgabe perfekt meistert. Auch auf eurer Ebene ist und bleibt das Verlassen der Komfortzone ein Experiment, das Mut und Neugierde erfordert. Aber: Ihr könnt euch rüsten, euch Begleiter suchen, reflektieren wo ihr steht, ohne unter Druck zu geraten ***). Auch ihr könnt bewusst und joggen nach außen kommunizieren, aufgrund welcher Erkenntnis ihr euren Weg wählt. Geht die Schritte in eurem Tempo, ohne (zu sehr) vom Markt und der Organisation getrieben zu sein. So bewusst vorgehen könnt, dank eurer Position, nur ihr. Also nutzt den Vorteil! Für euch und für euer Unternehmen.

Wenn euch interessiert, wie ich solche Transformationen angehe, dann schaut in mein gerade veröffentlichtes Konzept zu corporate co-(re-)creation. Wenn nicht, lasst es einfach.
So, das wars… zumindest bis auf die Frage(n): Was denkt ihr? Wie sollte sich Management eurer Ansicht nach verstehen? Wie entwickeln? Was tun und (vielleicht vor allem, was sollte es nicht mehr tun?
Was mir noch zu sagen/schreiben bleibt: Das Manifest und die Prinzipien findet ihr demnächst, wie schon das Manifest und die Prinzipien für zeitgemäße Führung, auf humenaning.com (mein „Webteam“ arbeitet noch dran).
*) Ums vorweg zu nehmen: Ich nutze zur Potenzialabschätzung ein selbst entwickeltes Tool, den CPC (oder etwas sperriger: Corporate Potential Calculator). Mehr dazu findet ihr hier.
**) Ein geniales Tool ist der von meinem Kollegen Raymond Hoffmann federführend entwickelte Management Model Canvas (wobei es mich mit Stolz erfüllt ein paar wesentliche Bausteine beigetragen zu haben). Mehr Infos gibt’s hier.
***) Auch hier gibt es einfach(e) gute Hilfsmittel, wie den „Agile Shift™“ von AGILITYINSIGHTS. Ausprobieren könnt ihr den gerne über meinen freien Demozugang.

13.02.19 | Blog, Leadership / Führung, Management, Zusammenarbeit |
Alles hat seinen Preis. Mit Blick auf meinen letzten Artikel hat auch der nachvollziehbare Wunsch einfach nur mit Herz und Verstand arbeiten zu können seinen Preis. So sehr ich mich über die positive Resonanz meines letzten Artikels freue, so sehr sehe ich auch nur Notwendigkeit ein wenig die andere, komplexere Seite eines „erfüllteren“ Arbeitens aufzuzeigen.
Ihr kennt doch den Spruch von dem Sack Reis, der in China umfällt. Früher ein Synonym für Irrelevanz. Heute wird klar: der Sack Reis scheint irgendwie doch Relevanz zu besitzen! Fast wie in der IBM Werbung für deren Cloud Services, in dem einige sonst unscheinbare Zusammenhänge aufgezeigt werden, kann dieser Sack Reis in einer so stark zusammengewachsenen Welt eben doch immense Auswirkungen haben.
Früher nannten wir es Chaostheorie, wenn wir nicht ableiten konnten, wie sich Dinge auswirken. Oder wir bemühten Schmetterlinge im Amazonas, um aufzuzeigen, dass aus einem Flügelschlag ein Orkan im Nordatlantik werden kann. Heute nennen wir es Komplexität und zitieren aus der Systemtheorie, wenn wir wissen, dass wir uns zwar gut vorbereiten und vorausschauend handeln können, wir aber das Heft ganz sicher nicht mehr in der Hand haben und jede noch so akkurate Planung spätestens in dem Moment obsolet ist, in dem man sie abschließt.
Immerhin haben wir es auf diesem Weg geschafft das Chaos verständlicher zu machen und doch wird noch immer gerne versucht Komplexität zu Kompliziertheit zu vereinfachen. So als könne man den Schmetterling nachträglich in ein Gewächshaus einsperren, damit der Flügelschlag keine verheerenden Folgen hat.
Aber Schmetterlings sind ja gar nicht mein Thema. Mir geht es um Arbeit, Zusammenarbeit, besser noch einfache & erfolgreiche Zusammenarbeit. Und damit wird’s dann hier jetzt etwas komplexer, gerade, weil gute Zusammenarbeit bedeutet „gesunden“ Menschenverstand und „gesundes“ Menschengefühl einfließen zu lassen. Und dabei ist es nur eine der Herausforderungen, dass wir eine unglaubliche Vielfalt an Wahrnehmungen von „gesund“ besitzen.
Das Thema sprang mich in der letzten Woche noch einmal intensiv an, als auf Spiegel Online Stefan Schultz in einem Essay darzustellen versuchte, was wohl nach der Leistungsgesellschaft kommt. Hintergrund für diese tatsächlich immer spannendere Fragestellung ist die Feststellung, dass sich auf einer 10-er Skala der „Ich-Entwicklung“ der Mittelwert langsam aber kontinuierlich immer weiter nach oben schiebt.
Natürlich kann man jetzt hingehen und sich denken „so what, klar entwickeln wir uns weiter“. Ich finde allerdings den Zusammenhang zwischen diesen Stufen der Ich-Entwicklung, die auf der Arbeit von Jane Loevinger zurückgehen und den Entwicklungsstufen z.B. die Frederic Laloux in „Reinventing Organization“ aufzeigt (und die auf Ken Wilburs „Spiral Dynamics“ zurückgehen) oder auch den Reifegrad von Organisationen, wie man ihn z.B. im Haufe Quadranten findet, spannend, denn sie sind zwar in der Theorie alle eigenständig, in der Praxis aber eng stark miteinander verwoben.
Ich fange nochmal bei der Ich-Entwicklung an. Bei der Betrachtung der einzelnen Beschreibungen dieser Stufen anschaut, wird klar: oh-oh, es gehört eine Menge dazu, dass wir friedlich, entspannt und positiv miteinander umgehen und arbeiten. Und, hey, so ganz gelingt dies schließlich auch nicht wirklich immer. (Fun-Fact – oder auch nicht so lustig: Donald Trump wird von manchen auf Stufe 3 eingeordnet (was auch Rückschlüsse auf dessen Wähler zulässt)).
Auf Spiegel Online sind die am häufigsten vorkommenden Stufen wie folgt beschrieben (wobei man sagen muss, dass niemand auf nur einer Stufe lebt – wir alle tragen immer Anteile verschiedener Stufen in uns!):
| Stufe |
Hauptcharakteristika |
Häufigkeit |
| E3: Selbstorientierte Stufe |
Lebensmotto: Sich durchsetzen. Typisches Auftreten: Opportunistisch. Stark auf den eigenen Vorteil bedacht. Gutes Gespür für Gelegenheiten, die eigenen Interessen durchzusetzen. Teils aggressiv-einschüchternd. Typische Denkweise: Fühlt sich schnell angegriffen. Freund-oder-Feind-Logik. Sehr kurzfristiger Zeithorizont. |
5 % |
| E4: Gemeinschaftsbestimmte Stufe |
Lebensmotto: Gemeinschaft. Typisches Auftreten: Loyal. Diplomatisch-vermittelnd. Stellt sich selbst zurück, um die Regeln und Normen der Bezugsgruppe zu befolgen. Argwohn gegenüber Menschen außerhalb der eigenen Gruppe. Teils blinder Gehorsam. Typische Denkweise: Schwarzweißdenken. Selbstwert hängt stark von der Akzeptanz anderer ab. Eher kurzfristiger Zeithorizont. |
12 % |
| E5: Rationalistische Stufe |
Lebensmotto: Abgrenzung. Typisches Auftreten: Legt Wert auf die eigenen Besonderheiten und Meinungen. Pragmatisch. Auf klare Verhältnisse bedacht. Mitunter perfektionistisch. Typische Denkweise: Aufbau von Expertenwissen. Feste, mitunter starre Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollten. Mitunter Probleme beim Priorisieren. Kurz- bis mittelfristiger Zeithorizont. |
38 % |
| E6: Eigenbestimmte Stufe |
Lebensmotto: Eigene Ziele erreichen. Typisches Auftreten: Klar abgegrenzt, dennoch prinzipiell Beziehungen auf Augenhöhe angestrebt. Stark selbstoptimierend, dadurch mitunter gehetzt. Typische Denkweise: Hinterfragt Motive. Analytisch. Differenziert. Beginnend selbstkritisch. Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren. |
30 % |
| E7: Relativierende Stufe |
Lebensmotto: Individualität. Typisches Auftreten: Größere Offenheit für andere Meinungen und Lebensweisen. Selbstverwirklichung jenseits sozial vorgegebener Rollen. Typische Denkweise: Relativiert zunehmend eigene und fremde Ansichten. Hinterfragt die gesellschaftliche Prägung der eigenen Sichtweisen. Wachsendes Bewusstsein für die Komplexität und Einzigartigkeit eines jeden Moments. |
10 % |
Quellen: Thomas Binder, Susanne Cook-Greuter, Jane Loevinger, Zusammenstellung der Spiegel Online Redaktion/Stefan Schultz
Was bedeutet es also für unsere Arbeit, wenn wir uns langsam von „E5: Rationalistische Stufe“ in Richtung „E6: Eigenbestimmte Stufe“ bewegen? Was bedeutet es für Führung, Organisationsstrukturen und Managementmodelle?
Spätestens an dieser Stelle schlägt die Komplexität voll durch, denn mit der Entwicklung der Gesellschaft, d.h auch mit der Entwicklung vieler Individuen in dieser Gesellschaft, sollten sich die Rahmenbedingungen für Arbeit ebenso weiterentwickeln – sonst geraten Unternehmen innerlich in Schieflage. Die so gerne singulär betrachteten Vorgänge der einzelnen Entwicklungen, zeigen in ihrem Zusammenhang betrachtet deutlich auf, dass gerade im Kontext von zeitgemäßer Führung und Management eine Menge auf uns zukommt.

Darstellung von Rod Collins, Director of Innovation at Optimity Advisors
Nicht, dass all das neu wäre. Ein Unternehmen zu führen, die Zusammenarbeit zu organisieren, bzw. die Grundlage und Rahmenbedingungen für „gute Zusammenarbeit“ zu schaffen ist bekanntlich eine echte und umfassende Herausforderung. Dennoch wird es immer bedeutsamer, sich der systemischen (nicht die systematischen) Zusammenhänge bewusst zu sein. Zu schnell geht im alltäglichen miteinander verloren, dass das einfache, lineare Schauspiel zwar so einfach zu verstehen und vermeintlich einfach zu steuern ist, es aber ein immer gefährlicherer Trugschluss ist, dies für die ultimative Weisheit zu halten.
Auch wenn das Leben oftmals vorgibt ein langsamer, stetiger Fluss zu sein, es gibt sie eben doch, die plötzlich auftretenden Stromschnellen, weil irgendwo 500km entfernt ein Starkregen niedergegangen ist. Die Dinge, die Menschen, die Prozesse, die Strukturen sind auch und gerade in Unternehmen immer enger miteinander verwoben. In lebendigen Organisationen sind sie, in gewisser Weise, jeden Tag neu, denn jeden Tag wirken neue Einflüsse auf das Gesamtsystem ein.
Doch, was kann man tun, ohne beim Versuch des Verständnisses zirkulärer Zusammenhangsbeeinflussung vollkommen den Verstand zu verlieren?
Je nachdem, in welchem Kontext und in welchen Aufgabengebieten man tätig ist, rate ich zunächst zu folgendem:
- gilt für alle: Nehmt euch 10 Minuten Zeit und schaut euch zumindest die grundlegenden Beschreibungen der Ich-Entwicklungsstufen (oder anderer „Persönlichkeits“analysen) an. Versucht auf dieser Basis zu verstehen, an welchen Stellen ihr anders denkt und handelt als andere in eurem Umfeld und nehmt dies zunächst einmal OHNE BEWERTUNG wahr – denn eine Bewertung verändert hier nichts außer eurer inneren Einstellung, was andererseits fatal enden kann.
Zu verstehen, warum jemand wie handelt, tiefer zu blicken kann euch aber den Weg eröffnen den anderen einfach besser zu verstehen, toleranter mit ihm/ihr umzugehen, es kann helfen die Kommunikation zu verbessern und Konflikte zu vermeiden. Wer sich und die Treiber und Sichtweisen anderer verstanden hat, gestaltet sich selbst den Boden, auf dem einfachere Zusammenarbeit gedeihen kann.
- gilt für alle, die Organisationsmuster beeinflussen: Die Strukturen, in denen (anschließend) Menschen Zusammenarbeit (sollen), hängen nicht (nur) von den Aufgaben und Rollen ab. Sie hängen immer auch von den Menschen ab, die darin wirken sollen. Auch wenn wir gewohnt sind, diese Grundmuster unabhängig von den Menschen zu gestalten.
Wo wir uns also in Laloux Entwicklungsstufen wiederfinden, welche „Farbe“ das Unternehmen hat, sollte zu den Menschen in der Organisation passen. (Wobei spätestens die Menschen in der Orga dafür Sorge tragen, dass sich die Farbe ändert, wenn sie nicht zu ihnen passt.)
Damit bestimmt nicht nur die Idee in einzelnen Köpfen, wie Strukturen, Prozesses, Entscheidungen aufgebaut und getroffen werden sollten, sondern in zunehmendem Maß auch die Menschen die sich („E6“) „eigenbestimmt“ einbringen (wollen).
- Gilt für die Top-Strukturgestalter, mithin die Top-Führung: Kein Mensch und keine Organisation (als Ansammlung von verschiedenen Individuen) agiert nur auf einer Stufe, wir brauchen Raum für Abweichungen vom eigenen Bild und zugleich allgemeingültige Prinzipien, an die sich alle halten können und wollen. In diesem Sinne tut eine „Visionsfilterblase“ gut, eine „Denk-/Verhaltens-/Gleichförmigkeitsfilterblase“ wäre fatal.
Beide Aspekte im Blick zu haben und die Be(ob)achtung von Regeln und Werten zu vollziehen ist eine immer wichtigere Führungsaufgabe.
- Die Aufgabe der Top-Führung, des Managementzirkels in diesem Zusammenhang ist sich die Systemik klarzumachen, das Zusammenspiel im internen, wie externen zu verstehen und zuzulassen. Sie sind es, die Regeln und Rahmen, und damit die „Farbgebung“ der Organisation Unternehmens im Blick haben müssen und zugleich die Menschen dazu finden, bzw. umgekehrt, die Entwicklungsstufe der Menschen erkennend die Farbe durch Regeln und Prinzipien der Zusammenarbeit anpassen müssen. Es ist ein Wechselspiel, dass bewusst betrachtet und mit dem umgegangen werden sollte. Es bestimmt mit wie viel Vertrauen, Ehrlichkeit und Offenheit im Unternehmen miteinander umgegangen werden kann.
Das Gesamtsystem jedes Unternehmens wirkt zum einen wieder zurück auf die Menschen darin und damit zum anderen nach außen auf die Gesellschaft. Wer sich dessen bewusst ist, hat viel (für sich) gewonnen.
Die in sich gewundenen und vielfach verbundene Dreifachhelix des Gesamtsystems einer Organisation, bestehend aus dem sozial-menschlichen, dem fachlichen und dem organisationalen Strang zu gestalten ist eine komplexe aber am Ende auch dankbare Aufgabe. Je mehr Zufriedenheit und Erfolg sich einstellen, je besser das Zusammenspiel funktioniert, desto mehr haben die Menschen darin die Chance sind und damit wiederum das Unternehmen weiterzuentwickeln – eine win-win Spirale. Eine Spirale, die ganz automatisch versteht, wann und wie der Sack Reis Bedeutung für die Organisation hat, einfach und auch weil Raum (und Freude) da ist, um mit gesundem Menschenverstand und gesundem Menschengefühl jeden (Arbeits-)Tag miteinander zu verbringen.
05.02.19 | Blog, Leadership / Führung, Management, Zusammenarbeit |
8:00 morgens – Arbeitsbeginn. In der Garderobe ist ausreichend Platz, um die Jacke aufzuhängen. Daneben sind zwei kleine, unauffällige Fächer mit den Aufschriften gMv und gMg. Hier ist Platz, um den gesunden Menschenverstand und das gesunde Menschengefühl für die Zeitdauer des Aufenthalts im Bereich des Unternehmens unterzubringen.
Dann geht’s los, ob an die Maschine oder ins erste Meeting ist egal, wichtig ist allein, die Ziele zu erreichen, den Anweisungen zu folgen und möglichst ungeschoren durch den Tag zu kommen.
Abends dann erst die Jacke, anschließend gMv und gMg aus den Fächern holen und ab nach Hause.
Oder, wie macht ihr das?
Die Arbeit mit gesundem Menschenverstand und gesundem Menschengefühl ist noch die Ausnahme – mit fatalen Folgen!
Klar ist das „böse Unternehmen“, in dem nicht gedacht und gefühlt werden darf, ein überzogener Stereotyp. Dennoch steckt noch immer zu viel Wahrheit darin, denn noch immer tragen wir viel davon in uns. In einem Unternehmen (mit) zu arbeiten erfordert schließlich offiziell noch immer rein rationales Handeln. Das Erreichen der Ziele und das strikte Befolgen der Anweisungen und Prozessrichtlinien gehört damit zu den kritischen Erfolgsmerkmalen – oder sollte ich schreiben gehörten?!
Unsere Sozialisierung prägt uns in diesem Kontext früh. Einzelarbeit und Durchsetzungsvermögen sind schon in der Schule Thema. Zwar wird immer mehr Wert auf Gruppenarbeit gelegt, gut vermittelt oder gar gelehrt, wie man Dialoge und Entscheidungsprozesse so moderiert, dass tatsächlich das beste Ergebnis für alle, statt des von den lautesten oder schnellsten favorisierten herauskommt, werden diese Kompetenzen selten. Weder von den Eltern, die es selten „besser“ wissen, noch von den – aus vielen anderen Gründen überforderten und oft demoralisiert, demotivierten – Lehrenden.
Und doch – die Zeit verlangt von uns, uns anders zusammenzuraufen, uns anders auszutauschen, einander besser zuzuhören, mehr miteinander statt gegeneinander zu arbeiten.
Die Zeit verlangt von uns, diese im nicht-Arbeitsalltag natürlich(st)en Kompetenzen, Kopf und Herz, auch im Arbeitsleben einzubringen.
Wo früher nur die Hände gefragt waren, ist heute mehr denn je der Kopf gefordert – der aber funktioniert nur dann wirklich gut, wenn er seinen stetigen Begleiter dabei hat – die Emotionen, die Gefühle, kurz, das Herz.
Alle die „neuen“ Buzzwords im Kontext Führung: Vertrauen, Wertschätzung, emotionale Intelligenz, Empathie, Verbundenheit, Augenhöhe, etc. – sie sind nicht nur so alt, wie die Menschheit, sie sind auch das, was uns eine sinnvolle soziale Interaktion im Leben überhaupt ermöglicht. Oder könnt ihr im Alltag so leben, wie im Industriezeitalter (und mit dieser Logik – zumindest in Teilen – wird ja heute noch geführt) geführt und gearbeitet wurde? Ganz ehrlich – ich kann das nicht.
Diesem tradierten Umgang miteinander zu entfliehen und das ganz Alte, das Natürliche, das Menschliche, wieder zuzulassen ist (aber) sauschwer. Frage: Ist euch selbst wirklich klar, welche Vorurteilen und mentalen Modellen ihr mit euch herumtragt? Könnt ihr vorurteilsfrei mit andern reden, arbeiten, ihnen zuhören? Entstehen bei euch, wenn ihr über das Verhalten anderer nachdenkt, nicht auch immer wieder Bilder im Kopf, die mehr aus eurer Erfahrung, als aus der erlebten Realität mit dieser Person entspringen? Könnt ihr den TIE-Break? Bewusst die Themen T=Tatsachen, I=Interpretationen und E=Emotionen „auseinanderbrechen“ und unterscheiden?
Das zu verändern, das Denken und Fühlen zu verändern, sich auf Neues einlassen zu können, erfordert viel Mut und Vertrauen. In sich selbst, wie auch in die anderen. Sich zu öffnen, die eigenen Emotionen wenigstens zum Teil mit einzubringen, statt sie 100% zu unterdrücken, ist in einer Welt, die dies kaum noch gewohnt ist, kaum möglich. Zudem ist es verpönt Angst oder Unsicherheit zuzugeben, wenn dann sollen bitte nur positive Emotionen, und dies nur gemäßigt, gezeigt werden.
Wer’s anders macht, wer viel zeigt, wer „echt“ ist, der wird zu schnell als „anders“ gebrandmarkt, ausgegrenzt, gemobbt. Das Selbstbewusstsein damit umgehen zu können, besitzen tatsächlich nicht viele. Diejenigen, die es besitzen, stehen als Querdenker und Hofnarren schnell unter Beobachtung (und besitzen oftmals zugleich viele heimliche Anhänger und Bewunderer).
Das sollten wir uns bewusst machen! Wir sollten uns jeden Tag bewusst machen, wie wichtig es ist, immer ein wenig mehr von uns zu zeigen, immer ein wenig mehr von uns einzubringen. Denn die vielen „Co’s“, die wie als Antwort auf VUCA (Volatilität, Unsicherheit, Complexity/Komplexität, Ambiguität) so dringend brauchen, das Co-Creation, die Collaboration, die Cooperation, die CoExistenz ehemaliger Wettbewerber als neue Partner, das alles braucht den ganzen Menschen im Unternehmen. Nicht nur seine arbeitsfähige Hülle, sondern eben auch Herz und Verstand, Kommunikationsfähigkeit und Sachkompetenz, Beziehungen und Entscheidungsfähigkeit, Emotion und Ratio.
Bewusstheit für die eigenen Denkmuster zu entwickeln, sich stetig selbst zu reflektieren ist ein mühsamer Prozess. Wenigen gelingt es ihn unbegleitet zu gehen. Zu verlockend sind die alten, vermeintlich einfachen Muster und Rituale. Leichter ist es da, sich in und durch die Gemeinschaft zu stärken, den Weg gemeinsam zu beschreiten. Hier, in der (gemeinsam) entwickelten Offenheit für gMv und gMg, liegen die „neuen“ (und doch so ganz alten) Kompetenzbereiche von Führung.
Diese Kompetenzbereiche brauchen zugleich ein stabiles Fundament, Rahmen und Raum, den sie mit dem Wissen und dem Willen engagierter Mitarbeiter füllen können. Sie brauchen ein Management, dass diesen Rahmen und Raum gibt, das verstanden hat, wie wichtig es ist, die Kunst zu beherrschen optimale Zusammenarbeit zu gestalten. Dieser Rahmen und damit gutes, zeitgemäßes Management entscheidet zunehmend über die Zukunft der Unternehmen.
In diesem Sinne, schaut nach, ob es bei euch an der Garderobe die beiden Fächer noch gibt. Wenn ja, macht sie auf und lasst den Inhalt raus. Anfangs vielleicht nur ein klein wenig. Ich verspreche, die Arbeit wird dann nicht nur einfacher, sie macht auch mehr Spaß und bringt mehr Erfolg.
Wer sich dafür interessiert, wie man mehr gMv und gMg in seiner Organisation zulässt, der möge mir (weiter) folgen. In den nächsten Wochen widme ich mich hier den Themen „neue“ Managementprinzipien und der Erneuerung von Unternehmen von innen heraus, dem „Corporate Renewal“. Wer sich dafür interessiert diesen Weg mit seiner Organisation zu gehen, meldet sich einfach jetzt schon. Ich verdiene mein Geld schließlich nicht mit Schreiben, sondern damit Kopf und Herz zu nutzen, um die Zusammenarbeit in Organisationen einfach erfolgreicher zu machen. 😉
Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme und die Arbeit mit euch! 🙂

 Beginnt beim (alten) Kopf des Fischs. Liebe Top-Manager, startet selbst damit die Parameter neuer Zusammenarbeit zu verstehen und zu leben. Startet mit einem (ggf.) neuen Verständnis für eure Aufgabe und geht dann erst die notwendigen Schritte, gemeinsam mit den übrigen Mitwirkenden in der Organisation, an **). Dreht den Spieß um und nehmt das Heft ganz bewusst selbst in die Hand. Es eröffnet euch die Chance die Organisation zielgerichtet in die Zukunft zu bewegen.
Beginnt beim (alten) Kopf des Fischs. Liebe Top-Manager, startet selbst damit die Parameter neuer Zusammenarbeit zu verstehen und zu leben. Startet mit einem (ggf.) neuen Verständnis für eure Aufgabe und geht dann erst die notwendigen Schritte, gemeinsam mit den übrigen Mitwirkenden in der Organisation, an **). Dreht den Spieß um und nehmt das Heft ganz bewusst selbst in die Hand. Es eröffnet euch die Chance die Organisation zielgerichtet in die Zukunft zu bewegen.