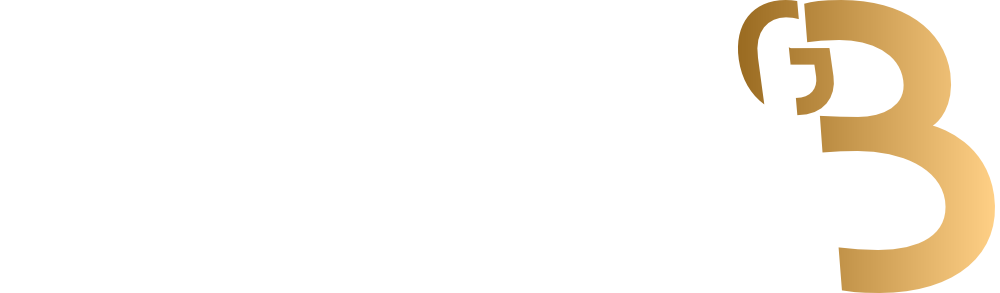09.10.19 | Blog, CoRE, Management, Management Insights, Organisationsgestaltung, Zusammenarbeit |
>>>> Ein Reflexionsimpuls
Vor ein paar Wochen hatte ich den Rand so richtig voll.
Der Parkplatz vor unserem Haus, auf dem im Normalfall mein Auto steht, hatte an vielen Stellen seine Farbe verloren. Statt eines satten Grüns war das Grau des Unterbaus sichtbar. Die untergemischte Erde war weggespült, dem Gras fehlte im Grunde alles, was es am Leben hätte halten können. Was mal so schön geplant und auch gemacht war, hatte sich verwandelt – war unansehnlich geworden. Nicht über Nacht, sondern schleichend und damit so, dass ich immer wieder verschoben hatte etwas dagegen zu tun. Bis vor ein paar Wochen.
Nein, ich werde hier nicht über die erstaunliche schnelle, wirksame und (hoffentlich) nachhaltige Arbeit an meinem Parkplatz berichten, jedenfalls nicht zu viel. Mir geht es darum, wie, woran und wann man erkennen kann, dass es Zeit ist, sich neu zu orientieren, das bestehende aus einer distanzierteren Perspektive zu betrachten, um dann zu tun, was (einem selbst und) dem Unternehmen guttut.
Aber, von vorne: Wenn ich mich umblicke, dann nehme ich an vielen Stellen eine zunehmenden und leider gar nicht mehr so neue Orientierungslosigkeit wahr. Der wohl dominanteste Einflussfaktor ist, wieder mal, unsere heutige Art zu kommunizieren, unser Wissen auszutauschen und miteinander Geschäfte zu machen. Schneller, größer, weiter – das Internet macht’s schon lange möglich. Und dabei steht diese Entwicklung, wie alle bahnbrechenden, umfassenden Entwicklungen der Menschheit, noch an ihrem Anfang. Die Digitalisierung und Automatisierung, die Mensch-Maschine-Einheit wird in den kommenden Jahren noch deutlich an Bedeutung gewinnen – auch wenn wir in Deutschland hier massiv hinterherhinken.
Dieses Hinterherhinken, gekoppelt, unser Umgang mit dem zunehmend schnelleren Wechsel von „Ist-Zuständen“ (Dynamik) und der wachsenden Anzahl von Einflussgrößen auf Entscheidungen und Aktivitäten (Komplexität), führen zu einem, wie ich es sehe, exponentiellen und gefährlichen Anstieg der Wahrnehmung von Unsicherheit. Unsicherheit auf einem, für ein wirtschaftlich sehr weit entwickeltes Land, erstaunlich hohen Niveau – was dem individuellen Gefühl aber ehrlich gesagt, vollkommen egal ist.
Die Unsicherheit ist da und wächst, ohne, dass wir uns in der Lage sehen, ihr zu begegnen. Der Lösungsansatz der Ambidextrie, des „sowohl-als-auch“s im Umgang mit dem Angang neuer Wege, erscheint in der alten Logik des linear Planbaren zu wage, die Mehrdeutigkeit zu schwierig und kostspielig aufzulösen. Was wäre schließlich, wenn man auf die falschen Pferde setzt. Da bleibt man halt lieber auf dem alten, müden Gaul sitzen.
Früher hat es geholfen, sich Rat von den klassischen Institutionen zu holen. Die religiösen oder politischen Führer, die großen Wirtschaftsbosse, die klassischen Bestimmer des Schicksals einer Gesellschaft und eines Landes, waren es, die (vor)dachten und lenkten. Heute haben sie längst kein griffiges Konzept mehr, um mit dem Wandel, den auch sie wahrnehmen, umzugehen. Das Resultat: ein Mangel an klaren Aussagen, ein „wir tun ja was, aber bitte immer nur so wenig wie möglich und höchstens so viel wie nötig“ und viel Stillstand. Schlimmer: Orientierungsloser Stillstand. Wir stehen im Nebel, und halten es für zu gefährlich uns zu bewegen, weil wir ja hören, dass da draußen ganz viel Bewegung ist und wir mit diesen Geräuschen zugleich nichts (mehr) anfangen können.
Die alten meinungs- und handlungsleitenden Institutionen sind heute durch eine unglaubliche Vielfalt an Nachrichten, Interpretationen, Kommentaren und Meinungen – auch und vor allem hier in den „social media“ – ersetzt worden. Wegweisern, die es erfordern, uns selbst mit den zuvor- und zugrundeliegenden Entwicklungen aktiv zu befassen, sie zu verstehen und uns in die Lage zu versetzen, sie im Kontext unserer moralischen und ethischen Vorstellungen zu interpretieren. Ganz ehrlich – wer macht das? Und wer ist dazu überhaupt zeitlich und intellektuell in der Lage. Ich habe bei vielen Dingen aufgehört, sie auch nur verstehen zu wollen.
Zurück bleibt Ratlosigkeit und Lähmung. Zu viele ungelöste Fragen und zu viele unkonkrete Antworten. Schlimmer noch: In dem Gefühl der Orientierungslosigkeit haben wir die Fähigkeit verloren, Chancen und Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Wir glauben nicht mehr nur an unsere erlernte Hilflosigkeit – wir glauben auch daran, dass es gar keinen gangbaren Weg mehr gibt.
Es stellt sich die Frage: In welcher Welt wollen wir eigentlich leben, in welcher Welt wollen wir zurechtkommen, in welcher Welt wollen wir arbeiten? Woran, und an wem, trauen wir uns zu glauben? Wem vertrauen wir in einer Welt, die uns zu Misstrauen erzogen hat und die uns mit Nachrichten und Informationen überschüttet, deren Wahrheitsgehalt und Relevanz wir nicht mehr auf einfachem Weg bestimmen können?
Welcher Weg führt aus diesem Dilemma?
Nein – auch ich habe keine eindeutige, einfache Lösung!
Was ich habe, ist ein Verständnis für grundlegenden Komponenten einer möglichen Lösung. Was immer wir tun können, es wird Werte und Themen beinhalten wie „Vertrauen“, „Offenheit“, „Leichtigkeit“, „geniale Einfachheit“, „Verständlichkeit“, „Modularität“, „Respekt“, „Toleranz“. Wir selbst brauche dafür das (wiedergewonnene) Verständnis, dass wir anpassungsfähig, innovativ, flexibel, schnell, bedacht, resilient agieren und reagieren können. Das in uns steckt, was wir brauchen, wenn, ja wenn wir es wagen, den Nebel zu verlassen.
Was darin mitschwingt, ist der „Rückgriff“ auf die Nutzung der „Intelligenz der Vielen“, die Nutzung dessen, was Cicero uns in „de res publica“ hinterlassen hat und was wir im positiven, inkludierenden Sinn als Gemeinwesen verstehen. Einem Gemeinwesen, dass für sich eine „Herrschaftsform“ findet, die zeitgemäß die Gegebenheiten und Notwendigkeiten abbildet. In Unternehmen in einer Form, die die Managementstrukturen so anpasst, dass sich der bestmögliche und bestgeeignete Mix an Bürokratie , Meritokratie (dem, was wir als „Leistungsgesellschaft“ verstehen), Adhocracy (der „Herrschaft“ der schnellen, spontanen, agilen Partizipation) und in Zukunft vielleicht auch Virtuecracy ( der „Herrschaft“ der erzielten Wirkung) ergibt.
In aller Kürze bedeutet das, dass niemand mehr allein die Herausforderungen der Zukunft voraussehen, voraussagen oder gar lösen kann. Wir können, müssen und sollten und zusammentun. In der Gesellschaft und vor allem auch in Unternehmen.
Doch davon sind wir weit entfernt.
Ich habe ihn den letzten zwei Jahren verschiedene Umfragen durchgeführt und begleitet. Das einhellige Ergebnis sind – und das bitte alles NICHT als Bashing verstehen, denn mir geht es darum dennoch einen Weg aufzuzeigen -:
- ein Mangel am Verständnis für dynamische Fähigkeiten im Management (kein Wunder, denn diese sind selten Thema von Aus- oder Fortbildungen),
- zunehmende Aktivität und Unruhe auf allen Ebenen der Unternehmen, mit dem Ziel, die als fehlend wahrgenommenen, zukunftsgerichteten Aktivitäten des Managements auszugleichen
und
- eklatant schlechte Rahmenbedingungen auf der Ebene der Basis guter Zusammenarbeit, d.h. z.B. bei der Kommunikation, Partizipation, Nutzung von Chancen, Wertschätzung u.v.a.m. .
Dies alles zudem gepaart mit einem immer wieder zu erkennenden blinden Flecken bei Top-Führungskräften und deren, zumindest nach außen getragenen, rosaroten Brille bei der Beurteilung der Situation. (Mehr Infos zu den Umfragen gerne auf Anfrage.)
Was braucht es noch, wenn wir in und als Unternehmen wieder Orientierung erlagen wollen.
Die Kollegen von McKinsey haben in einem ihren letzten Podcasts die Bedeutung von „Organizsational Health“ für jedwede Entwicklung innerhalb von Organisationen, insbesondere bei Change und größeren Transformationen und organisationalen Metamorphosen herausgestellt. Schon der römische Dichter Juvenal rief seine Mitbürger dazu auf, statt die Götter ohne Betrachtung der Konsequenzen mit törichten Bitten zu belästigen, sie doch nach „mens sana ich corpore sano“ zu bitten, nach einem gesunden Geist in einem gesunden Körper. Ähnlich ist es in Unternehmen, statt zu hoffen, dass die Veränderungen für sich neue Orientierung bieten, sollte der Prozess mindesten von drei Seiten aus angegangen werden.
Zum einen ist auch hier der gesunde Körper wichtig. Im Fall von Unternehmen sind dies allem voran die Rahmenbedingungen auf denen das Zusammenspiel der Komponenten, der Organe und Muskeln, der Knochen und Nerven aufbaut. Neben den Strukturen und Prozessen gehören hier auch die Kultur und die Kommunikationswege und -eigenarten dazu. Ein gesunder Organisationskörper, der ohne Wehwehchen, ohne Ballast und schmerzfrei (er)agieren kann ist die Grundlage. Ein Grund warum ich daran arbeite, Hemmnisse, Stolpersteine, überflüssige Bürokratie und Prozesse in Unternehmen soweit wie möglich zu reduzieren. (Was McKinsey seit ein paar Jahren als „Organizational Health Index“ vermarktet betrachtet AGILITYINSIGHTS seit mehr als 16 Jahren im Kontext der „Agile Insights“. Am Montag, dem 14.10. hält Lukas Michel dazu, bzw. zum „Agilen Paradigmenwechsel“ ein kostenfreies Webinar.
Zum zweiten: der gesunde Geist. Das Zusammenspiel von gesundem, gemeinsamem Menschenverstand und gesundem, gemeinsamem Menschengefühl. Der Austausch, die Möglichkeit sich einzubringen, die Chance zur Partizipation, um den oftmals vielen guten Ideen und Impulsen Raum und Stimme zu geben. Hier wird im alten Verständnis einer „von oben“ lenk- und planbaren Organisation, einer aus der Vielfalt der Beteiligten geborenen, oder zumindest wahrgenommenen Notwendigkeit festgelegter Ziele, noch zuviel vorhandenes intellektuelles Potenzial liegen gelassen. Ein Bereich den z.B. CoRE sehr direkt angeht.
Zum dritten sollte der Weg, gerade wegen der bestehenden Orientierungslosigkeit in kleinen, klaren Schritten gestartet werden. Den Rubikon-Prozess als Leitlinie nutzend, kann man beginnen das eigentliche Bedürfnis, z.B. nach (neuer) klarer Orientierung in Richtung Zukunft klar zu benennen. Und gerade diese Orientierung ist in der heutigen (Um)Welt leider keine Selbstverständlichkeit mehr.
Im zweiten Schritt wird das Motiv benannt: Will ich als Top-Führungskraft wieder in die Lage kommen, zukunftsweisend agieren zu können? Will ich „nur“ den Profit und/oder den Erfolg kurzfristig optimieren oder langfristig und nachhaltig etwas für das Unternehmen und die Menschen darin tun? Ein Motiv kann ebenso sein, im allgemeinen Chaos endlich wieder „ruhig“ die „richtigen“ Schritte gehen zu können.
Anschließend geht es um erste, bewusst kleine Impulse, s.d. aus dem Motiv etwas konkreteres entstehen kann. Einfach ist, Menschen ins Unternehmen einzuladen, die zu einzelnen kleinen Elementen und Entwicklungsrichtungen konkrete Erfahrungen, Reflexionen und Impulse einbringen. Es geht erstmal nur darum miteinander zu reden und zu schauen, ob das was da eingebracht wird, im Unternehmen auch anknüpfungsfähig ist.
Ist damit klarer, wohin erste weitere Schritte möglich sind, können die Dialoge und Diskussionen zu den Fokusthemen vertieft und intensiviert werden. Ob nur intern oder im Mix mit weiteren Impulsgebern – beides ist möglich. Wichtig ist, aus der Theorie Optionen für eine konkrete praktische Umsetzung dieser kleinen Schritte zu gewinnen, um dann, im letzten Schritt tatsächlich mit der Gestaltung ‚einer‘ der vielen möglichen Zukünfte zu beginnen.
Was hier nach einem langen Prozess klingt, geht verblüffend schnell, wenn die Bereitschaft besteht, sich seines Motivs klarzuwerden. Es geht nur um die eine kleine, einfach Frage: Will ich das Unternehmen in der Zukunft bringen und wenn ja, bin ich bereit, mich mit neuen Orientierungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen?
Eine Frage, die (für mich) im Grund keine Frage sein kann und darf.
Und zum Schluss dann doch noch eine Warnung. Es gibt auch in unseren „modernen“ Zeiten viele Propheten, die zu wissen vorgeben, wie und wohin sich euer Unternehmen entwickeln soll und kann. Sie kommen mit allerlei Fläschchen und Tinkturen, sie haben Lösungen in ihren Schubladen, die „erfolgreich“ schon in zig Unternehmen implementiert wurden….. Wie viele davon waren wohl auch schon bei den Unternehmen, deren Pleiten in den letzten Jahren durch die Medien gingen…?
Das Gras auf meinem Parkplatz wächst übrigens wieder. Es wächst nicht schneller, wenn ich daran ziehe, aber das brauche ich auch nicht, denn ich habe ihm Rahmenbedingungen gegeben, die Erde, den Dünger, das Wasser, das Licht und Kohlendioxid, die es ihm leicht machen, sich zu entfalten. Manchmal ist es einfach, wenn man nur auch anfängt.
02.10.19 | Blog, CoRE, Leadership / Führung, Management, Organisationsgestaltung, Zusammenarbeit |
>>>> Perspektive
New Work heutzutage nochmal in einem Blogbeitrag zu thematisieren, erscheint auch für mich selbst eher befremdlich. Das zeigt sich schon daran, dass ich seit fast zwei Wochen mit dem Intro für diesen Artikel hadere. So viel scheint klar und doch ist alles fuzzy, undurchsichtig, vielschichtig. New Work ist schließlich, trotz der zunehmenden Zahl an Büchern zum Thema, kein eindeutiges Modell, es steckt keine Methode und keine klare Vorgehensweise dahinter.
Nachdem ich mich lange mit New Work befasst habe, mit dem Mehrwert (?) von Kickertischen, von neuer Bürogestaltung, von Feelgood Management und dem mehr an „individual freedom“, der Freiheit das zu tun, was man wirklich, wirklich, wirklich will – bzw. tun soll, damit das Unternehmen floriert (denn dem Bergmannschen Ideal ist wohl kaum jemand, geschweige denn ein Unternehmen jemals nahe gekommen), bin ich zugleich desillusioniert, wie auch ambitioniert das Thema weiter und tiefer zu denken und zu tragen.
Eine Frage des Start- und Standpunkts
Viele Startups und Konzerne scheinen schon mitten in der neuen Arbeitswelt angekommen zu sein, zumindest wenn man der Außenkommunikation Glauben schenken will. Wobei in beiden nach meiner Erfahrung und bei näherer Betrachtung auch ein guter Anteil „Außen hui, innen Pfui“ vorhanden ist.
Dazwischen steckt irgendwo die große Masse des Rückgrats der deutschen Wirtschaft, der Mittelstand, wo sich noch immer der eine und die andere fragt, was „New Work“ denn nun eigentlich wirklich ist und ob, beziehungsweise was das bringt. Und auch wenn „der Mittelstand“ immer wieder als eine einheitliche Masse dargestellt wird, wissen wir doch alle, dass die Ausgangslagen nicht unterschiedlicher sein könnten. In den einen Unternehmen wird ohnehin schon immer nach den „neuen“ Ideen gearbeitet, in den anderen ist das Unternehmensklima noch näher an der Katastrophe, als es Weltklima derzeit ist. Doch hier wie da gilt noch mehr als beim Weltklima: Es ist in vollem Umfang menschengemacht.
New Work – der Klimaretter?
Um es vorweg zu nehmen: Die heute vielfach gelebte Idee von New Work, jenseits von Frithjof Bergmanns Startimpuls, Arbeit zu etwas zu machen, dass man wirklich, wirklich, wirklich will, ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Sie taugt tatsächlich dazu das Unternehmensklima zu retten. Doch stellt sich die Frage, welche Ansätze, welches Klimarechenmodell jeweils angewendet werden kann. Wenn ich auf meine Regenradarapp schaue, zeigt diese zwar immer im Detail an, wo es in den letzten Stunden geregnet hat – der Blick in die Historie ist einfach und exakt -, oftmals ist jedoch die Vorhersage für die nächsten 2 Stunden noch sehr fehlerhaft.
Wie soll es da gelingen Ansätze und Modelle zu schaffen, Entwicklungen in Unternehmen vorherzusehen, wenn es sich nicht um EIN (Wetter)System handelt, sondern um Millionen kleinerer Unternehmenssysteme mit weiteren Millionen Impulsgebern und Schnittstellen in die Außenwelt.
„Das richtige“ New Work
Kann es da überhaupt einen „richtigen“ New Work Ansatz geben?
Ich behaupte: Es gibt ihn. Denn New Work, in all seinen Erscheinungsformen betrachtet und konsequent weiter gedacht, mit all seinen Ideen und Impulsen, um Arbeitswelten, Arbeitszeiten, Arbeitsorte, Rollen, Strukturen, Hierarchien, Führung, Bezahlung, Kommunikation, Interaktion, Recruiting, Stakeholderbindung, Innovation, Individualität, Führung, Flexibilität besser, schneller und breiter zu definieren und zu implementierten, bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dem Menschen im System, d.h. Kunden, Mitarbeitern, Investoren, Partnern, mehr Raum und Möglichkeiten zu geben, das System bewusst und aktiv mitzubeeinflussen.
Damit setzt New Work ein Systemverständnis voraus, dass seit der Industrialisierung oftmals verloren gegangen zu sein scheint. Ein Systemverständnis, das nicht den Erfolg, die Leistung, die Planung, die Standardisierung und Normierung ins Zentrum stellt, sondern den Mensch in seiner Vielfalt und (Un)Berechenbarkeit, mit seinen persönlichen Zielen, seinen Erwartungen, Emotionen, Befindlichkeiten, seiner Sehnsucht nach Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmtheit, Zugehörigkeit und Meisterschaft in den Fokus rückt. Es geht darum Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass er und sie sich einbringen können und wollen, mit ganzem Kopf, ganzem Herz und ganz viel Sinn. New Work ist damit nichts anderes, als der Begriff, der den Wunsch nach mehr gesundem Menschenverstand und gesundem Menschengefühl Ausdruck verleiht.
New Work ist Teil der Antwort auf eine unbekannte Frage
Doch auch wenn New Work aus dieser Perspektive so spannend, interessant und zugleich umfassend und komplex klingt, die Frage die Eigentümer und Unternehmen beschäftigt nicht, wie es, um des Menschen willen gelingt, ihm oder ihr mehr Raum zu geben Ihre Frage ist, wie es gelingen kann, sich bestmöglich auf die sehr unterschiedlich daherkommenden Zukünfte einzustellen und damit die Zukunft des Unternehmens selbst zu sichern.
Wenn nicht nur nichts bleibt wie es war, sondern die Veränderungen schneller wirbeln als ein Hurricane, wenn Planbarkeit der Vorbereitung auf eventuell, vielleicht Mögliches weichen muss, wenn zudem qualifizierte Mitarbeiter (d.h. die für die zukünftigen Aufgaben irgendwo zwischen Digitalisierung und soziale Kompetenz qualifizierten Mitarbeiter), nicht nur in der Zahl weniger werden, sondern auch die aktuelle Lehre (die oft eine Leere gleicht) zu wenig geeignet ist, um „nachzuliefern“, wenn das alles zusammenkommt, wenn selbst die Detailfragen noch unklar oder unbekannt sind, wie, um alles in der Welt, soll und kann man dann sinnvoll reagieren?
Schockstarre als erste natürlich Reaktion ist das, was wir noch vielfach wahrnehmen. Ungläubiges Staunen, dass die Fachkräfte tatsächlich rar werden, dass Wettbewerber ganz anders und dennoch weit erfolgreicher arbeiten, dass kleine Startups große Konzerne in Nischen aushebeln und dann ganz aus dem Markt werfen.
Im zweiten Schritt wird Schwarzer Peter gespielt: Da wird von Führungskräften beklagt, dass die Mitarbeiter nicht fit genug sind für die Digitalisierung und die Mitarbeiter beklagen, dass die Führungskräfte die Digitalisierung und damit die Zukunft verschlafen. Da wird nach mehr Regulierung gerufen, nach Unterstützung bei Forschung und Innovation. Da wird im Außen nach dem Heilsbringer gesucht und nach innen gejammert.
Erst im dritten Schritt wird begonnen den Blick nach innen zu wenden. Zunächst geht es an die Symptome, die offensichtlichen Bereiche mit denen Arbeit angenehmen gemacht werden kann. Hier sind es die Obstteller, die Kickertische und Sofaecken, die im Job das Gefühl geben sollen, zuhause zu sein – ohne ein Zuhause zu bieten. Da wird von Sinn gesprochen aber zu oft auch zu wenig Ankerpunkte für Identifikation und Sinn gegeben. Da wird erwartet, dass dem kostenlosen Smoothie immerwährende Treue folgt.
Dann, im vierten Schritt, wird begonnen 1 und 1 zusammenzuzählen. Denn, auch wenn Work-Life-Blending in Zeiten von Smartphones und omnipräsenten und omnitemporären Zugangsmöglichkeiten zur (Wissens)arbeit oder zur Arbeitsplanung und Kommunikation in Produktion, Sozialwirtschaft und Handel, zu einem Normal- und Dauerzustand wird, ist dies kein Grund Privates und Arbeit zu einem indifferenten Eintopf zusammenzurühren. 1und 1 zusammenzuzählen bedeutet Arbeitsstrukturen zu schaffen, die Zusammenarbeit leicht und erfreulich machen. Es geht darum, im Grunde ganz banal, Hemmnisse und Blockaden abbauen, so dass mehr Freude beim Arbeiten entsteht, ohne dass man dem Gefühl anheimfällt, sein „Zuhause“ in der Arbeit finden zu müssen.
Ehrlichkeit und Vertrauen
Es lohnt sich diesen Weg und diese Schritte klar auszudifferenzieren, sich bewusst zu machen, in welchem Bereich der Organisation, mit welchen Menschen, Strukturen und Prozessen, man wo steht. Es hilft, sich bewusst zu machen, in welchen Themenbereichen soziales, fachliches und organisationales angeschaut, angepasst und neu etabliert werden kann und muss, damit, gerade in immer schneller veränderlichen, immer komplexeren Umfeldern, ZusammenArbeit (weiterhin) gut gelingen kann. Es ist unabdingbar, dazu bewusst in den Spiegel zu schauen, ich nur individuell, sondern auch als gesamte Organisation und (endlich) wieder ehrlich zu sich zu sein und gemeinsam zuzugeben: Eigentlich könnten wir deutlich besser sein.
Es ist die Chance auch als Organisation wieder mehr Vertrauen zurückzugewinnen, in sich selbst und das Vertrauen der Stakeholder.
Viele Wege führen zum ‚Mensch im Fokus‘
Nur so werden die Abkürzungen sichtbar, die auch dieser Weg bietet, Abkürzungen, die sehr unterschiedlich sichtbar werden und gangbar sind. Wie ein LKW nicht auf einem Bergpfad den Pass überwinden kann und ihm geraten werden sollte den Tunnel zu nehmen (auch wenn er dadurch keine neuen Perspektiven erlangt), so müssen Konzerne andere Wege gehen als Startups (auch wenn es manche versuchen, naja, ihr kennt wahrscheinlich meine Kritik an dieser Stelle). Und ebenso sind im Mittelstand für inhabergeführtes 30 Mitarbeiter Familienunternehmen andere Wege möglich und sinnvoll als für ein börsennotiertes Unternehmen mit 5.000 Beschäftigten (oder sich es doch schon Mitwirkende?).
Und dennoch ist allen Wegen eines gemeinsam: Der Mensch wird immer mehr in den Fokus gerückt. Die Aufgabe der Organisation(sstrukturgeber) ist es immer mehr, allen Ballast, alle Hemmnisse alles abschreckende aus dem Weg zu räumen, s.d. optimale Zusammenarbeit möglich ist. Das (für mich) ist der Kern dessen, wofür „New Work“ heute als Synonym steht und das vor Jahrzehnten mit den Ideen von Frithjof Bergmann seinen Anfang genommen hat.
P.S.
Zusammen mit meinen freikopfler Kollegen Heiko Bartlog, Christoph Karsten und allen Teilnehmern, will ich am Mittwoch, dem 16. Oktober um 15:00 Führung im Kontext New Work frei denken. Noch sind Plätze übrig.
P.P.S.:
Warum ich das alles so sehe?
Weil ich seitdem ich denken kann, in Zusammenhängen und Systemen denke. Weil ich immer den best case und den worst case verstehen wollte. Weil ich immer versucht habe Lösungswege aufzuzeigen.
Wozu hat das geführt?
Es hat dazu geführt, dass ich AGILITYINSIGHTS nutze, um den Status Quo einer Organisation ihr selbst, also den Menschen darin, leicht verständlich zu visualisieren. Es hat dazu geführt, Managementmodelle nur zu denken, Transformationsansätze, wie den ‚Corporate Co-Recreation‚ zu entwickeln, um den Wandel gemeinsam zu gestalten und es hat mir den Weg zum ‚CoRE Wheel‘ und CoRE Canvas geebnet, der die wichtigsten Themenfelder aufzeigt und diskutabel macht, um so leichter zu Lösungsansätzen zu kommen.
Warum ich das mache?
Weil es mir Freude bereitet, die Freude am Tun in den Augen der Menschen (wieder)zuentdecken, wenn sich Organisationen auf den Weg gemacht haben, sich neu zu gestalten.
Warum schreibe ich darüber?
Weil ich so für mich selbst die Gedanken ordne und weiter in die Tiefe vordringe. Und weil ich es nicht einsehe, euch das vorzuenthalten, gibt es doch Gelegenheit und Anstoß, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten.

25.09.19 | Blog, Management, Management Insights, Nachhaltigkeit, Organisationale Agilität, Zusammenarbeit |
„Zögern ist der Lohn der Angst, Hast, die Quittung für das Zögern. Bedachte Schritte sind es, die Angst, Zögern und Hast überwinden helfen.“
Immer mehr Unternehmen sind in der Dauertransformationswelt angekommen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung egal, ob man es „loop approach“, der „Company rebuilding“, oder wie ich, es „Corporate CoRecreation“ nennt, es geht (idealerweise) gemeinsam, immer schneller, immer weiter. Soweit zur Theorie.
In der Praxis sind wir von diesem aktuellen Idealbild – selbst in der Filterblase, die sich hier versammelt hat, weil wir den Wert erkannt zu haben glauben – zum Großteil und im Wortsinn ‚furchterregend‘ weil entfernt. Wenn meine Umfragen (LINK) auch nur im Ansatz die Tendenz richtig widerspiegeln, ist der Weg noch immer extrem weit und teilweise nicht einmal ein Anfang gemacht.
Manager sind auch nur Menschen
Wie schon immer fühlt sich die Gegenwart unsicherer, schneller, dynamischer und komplexer an, als die schon gemeisterte Vergangenheit. Die gewohnte Verlässlichkeit der Zukunft hat uns im Stich gelassen. Planungen sind kaum mehr möglich, Vorbereitungen schwer zu treffen, weil wir den zukünftigen eigenen Weg nicht mehr gut genug abschätzen können. Die Zukunft erscheint strahlend wie eine Supernova und zugleich gefährlich wie ein schwarzes Loch.
Obendrein erwarten „alle“ von „ihren“ Top-Führungskräften, dass sie die Gegenwart UND Zukunft des Unternehmens sicherstellen, die Sicherheit erhöhen, Zuversicht vermitteln und Stabilität schaffen. Da fühlt sich so mancher wie im Spagat auf einem Hochseil, allerdings ohne das Bewusstsein dieses Metier zu beherrschen und mit ausreichend Mut und Zuversicht auf dem Seil agieren zu können. Schlimmer: Wer genau hinschaut, erkennt, dass an dem Mensch, der trotz allem den Spagat voll- und vorführt, alle diejenigen hängen, die sich in Bezug auf ihre persönliche Zukunft darauf verlassen (müssen), mitgetragen zu werden.
Kein Wunder, wenn man da etwas Verhalten agiert. Manager sind schließlich auch nur Menschen.
Was hat das alles mit dem „Birkenstock Effekt“ zu tun?
Nein, es geht hier nicht darum Sandalen des gleichnamigen Schuhherstellers zu benutzen, um auf dem Seil besser voranzukommen. Dennoch sind diese Namensgeber für den Effekt, der sich einstellt, wenn man beginnt das Seil (natürlich im übertragenen Sinn) in den Blick zu nehmen.
Die Bezeichnung stammt von meinem sehr geschätzten Kollegen Lukas Michel, der damit eine immer wieder auftretenden Entwicklung auf dem Weg in die Zukunft von Unternehmen bezeichnet, deren Auswirkungen man sich schon im Vorfeld bewusst machen sollte. (Insbesondere nutzt und erklärt es den Effekt immer in seinen sehenswerten Webwaren zum „Agilen Paradigmenwechsel“.)
Ein Transformationsbereich, dass heute in den meisten Organisationen zum (Change)Alltag gehört ganz natürlich Dauerthema werden muss ist… (Bitte einen gähnend langweiligen Trommelwirbel vorstellen) ganz klar: die Digitalisierung, Automatisierung bis hin zur Nutzung von AI, AR, VR und Big Data (d.h. den richtigen Fragen, um die Daten auch sinnvoll zu nutzen).
Wer sich damit befasst hat weiß, nach und mit der Digitalisierung verändern sich Strukturen und Prozesse, kurzum nicht nur das Betriebssystem in den Computern und Maschinen bekommt ein update, sondern das Betriebssystem des Unternehmens, die Regeln und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit werden dabei, bewusst und (oft auch) unbewusst überarbeitet und an vielen Stellen neu definiert. Mit diesem Betriebssystem, dem für optimale Zusammenarbeit, wandelt sich die Kultur, dieses Gebilde aus Vorgaben (eben diesen Regeln und Rahmenbedingungen), der Exekutive (der „Führung“ die einerseits die Regelkonformität durchsetzen soll und andererseits den Menschen gegenüber steht) und den Menschen in der Organisation mit all ihren persönlichen Ansichten, Befindlichkeiten und Gewohnheiten.
Das Lösung(buzz)wort und -ansatz, um mit all dem umzugehen, ist „agiles Management“. Also Führung, die bereit und (be)fähig(t) ist, Anpassungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten zu antizipieren & erkennen und diese ins Unternehmen einzubringen. Doch das ist deutlich leichter gesagt (und geschrieben) als getan. Auf dem Weg dahin lauert so manche Stolperfalle, wie etwa eben jener „Birkenstock Effekt“.
Der kleine, große Schritt vom „Veränderer“ zum „Befähiger“
Die Entwicklung, die Unternehmen auf dem Weg zu „mehr digital“ und damit „neuer Kultur“ und eben auch mehr „agiler Zusammenarbeit“ beschreiten, hat Lukas in 6 Stufen einer „agilen Reife“ differenziert. Nicht nach Lust, Laune, sondern, weil in den Analysen, die wir im Netzwerk von AGILITYINSIGHTS durchführen, immer wieder die gleich Muster auftreten.
Mit Blick auf das im Unternehmen (er)lebbare und gelebte flexible, kommunikative, zielgerichtete und anpassungsfähige (= agile) Miteinander, lassen sich immer wieder signifikante Unterschiede in Bezug auf den agilen Reifegrad, ausgedrückt in Parametern wie den Erfolg, dynamische Fähigkeiten, dem benutzen Managementmodell, der Art der Entscheidungsfindung sowie weiterer relevanter Aspekte und insbesondere die Korrelation zum faktischen Geschäftsergebnis identifizieren.
Auf dem Weg von „Widerspenstigen“ zu den „Pionieren“ einer neu gestalteten, systematisch verstandenen Zusammenarbeit, wird bei vielen der so untersuchten Unternehmen, eine markante Abweichung zwischen der Entwicklung der agilen Fähigkeiten und der Geschäftsergebnisse sichtbar – eben der „Birkenstock-Effekt“. Gerade, wenn der Wandel von der Kundenzentrierung der „Veränderer“ hin zur Menschenzentrierung der „Befähiger“ stattfindet, wenn es also nicht nur um die Kunden, sondern um die Menschen, die mit dem Unternehmen in Beziehung stehen, ganz allgemein geht, d.h. auch um Mitarbeiter, Investoren und alle anderen direkten Stakeholder, in diesem so kritischen Moment der Neuorientierung, wenn alle wie gebannt eine Performancesteigerung erwarten, fallen plötzlich die Geschäftsergebnisse.

©2019 AGILITYINSIGHTS – Auszug aus dem Webinar „Der agile Paradigmenwechsel“
Was läuft da falsch?
Keine Frage, der Schritt weg von der absoluten Kundenzentrierung, der oft auch damit verbunden ist, neue Kennzahlen für die Zusammenarbeit zu finden und zu etablieren, der Schritt, der es erfordert, Prozesse und Strukturen neu zu denken, der Schritt, der für viele (auch und gerade für Führungskräfte) bedeutet sich nur zu orientieren, ist mit Aufwand verbunden.
Spannend, ist, dass er normalerweise nicht zu Umsatzeinbußen führt – auch wenn man sich augenscheinlich weniger um den Kunden kümmert (was in dieser Form ja gar nicht zutrifft – im Gegenteil!). Doch steigen in diesem Moment oft die (Transformations)Kosten in sehr subtilen Randbereichen.
Warum?
Was es zu bedenken gilt: Diese ersten Schritte gehen viele Unternehmen entweder (fast) alleine, in dem sie ausprobieren, was die Chefs und die Führungsetage im Austausch mit anderen, oder beim Stöbern in Büchern und Blogs an guten Ideen mitgenommen haben oder sie werden von Beratungskollegen, mit Wucht durch den Prozess geschoben – etwas, dass ich gerade aus größeren Unternehmen immer wieder höre. Fast immer als Klagelied und bislang nie als Jubelruf.
Im ersten Fall, wenn das Unternehmen viel alleine probiert, besteht die Gefahr in Dinge zu investieren, die zwar woanders zu funktionieren scheinen, aber für die eigene Organisation nicht passen. Nicht überall ist das „von oben“ angeregte “Du“ hilfreich, nicht immer sind es die Kickertische. Feelgood Manager brauchen genauso ein Umfeld, indem sie akzeptiert werden und etwas bewegen können, wie Sofas nicht überall geeignet sind, um die Kommunikation zu fördern. In der Spitze sind es dann die Obstteller und „Ökosandalen“ die helfen sollen, besser miteinander auszukommen. Kurz, es wird viel ausprobiert, ohne dass diese Maßnahmen sich tatsächlich auch positiv auswirken. In der Wahrnehmung, dass die Entwicklung noch nicht messbar ist, fehlt manchmal eben auch ein wenig Augenmaß gekoppelt mit gesundem Menschenverstand und gesundem Menschengefühl.
(Disclaimer: Während ich hier sitze und schreibe, habe ich auch solche Sandalen an 😉 )
Im zweiten Fall und ohne ins Bashing abzudriften: Wenn die Beraterkollegen hereingeholt werden, um das „XYZ“-Modell im Unternehmen zu etablieren (für XYZ denkt ihr euch bitte den aktuellen Trend, von ROWE, über Holokratie, Spotify und das was gerade sonst irgendwo aufpoppt), wenn die Tagessätze und auch die Erwartungen aller Beteiligten hoch sind, die Ergebnisse sind….. es nicht immer. Hier tragen (aus meiner bescheidenen Sicht) am Ende leider alle gemeinsam die Kosten, auch wenn es das einfacher macht, die Schuld auf den/die Berater zu schieben.
Von Ökosandalen und Sicherheitsschuhen
Andererseits: Natürlich muss es gerade in dieser Phase darum gehen, die bestehenden und altbewährten(?) Prozesse und Strukturen dahingehend zu reflektieren, wie sehr sie tatsächlich(!) zur Wertschöpfung beitragen oder inwieweit sie eine gute Zusammenarbeit eher behindern. Sicherheitsschuhe sind in bestimmten Bereichen einfach ein Muss, auch wenn Ökosandalen bequemer erscheinen.
Da kann es angebracht sein, mehr oder größere Kaffeeküchen einzurichten, es kann aber auch helfen Kaffeemaschinen abzubauen, damit die Kollegen sich öfter treffen. Es kann helfen, alle Hierarchien abzubauen, aber manchmal brauchen die Mitarbeiter mehr statt weniger führende Unterstützung. Und diese Liste lässt sich fast beliebig fortsetzen. Diese Missinterpretationen der Schritte auf dem „richtigen Weges“ sind es, die große Teile des Effektes verursachen.
Ein sehr kritischer und bewusster Blick kann zwar nicht unbedingt den Effekt verhindern, er kann aber dafür sorgen, gerade wenn diese Themen offen diskutiert werden können, dass deutlich sensibler mit den Investitionen umgegangen wird. Agilität entsteht nicht durch die Gießkanne vermeintlicher Mitarbeitergoodies und eine optimale Zusammenarbeit hat nichts mit Sofaecken zu tun. Hier geht es viel mehr um die richtigen Herausforderungen und einen (selbst)bewussten Umgang mit Fähigkeiten und Befähigungen.
Und: Der Birkenstock-Effekt ist eine Gefahr für die Transformation, den er gießt Öl ins Feuer der Kritiker. Es lohnt auf dem Weg umfassend, systematisch, gemeinsam und bewusst zu betrachten, was auf der Ursachenebene die Situation verbessert, was als Placebo hilft Dinge zu akzeptieren und welche Symptome gar nicht erst bearbeitet werden sollten.
Ich wünsche euch jedenfalls auf dem Weg gutes Gelingen und die für euer Vorhaben optimale Unterstützung. Eine Aufgabe, die ich in ausgewählten Fällen auch selbst immer mal gerne übernehme. Denn am Ende spornt (auch mich) nichts mehr an, als das Leuchten in den Augen der Menschen, wenn Zusammenarbeit tatsächlich, leichter, einfacher und rundum erfolgreicher funktioniert.

11.09.19 | Allgemein, Blog, Management, Management Insights, Zusammenarbeit |
Wie schön wäre die Welt, gäbe es nur EIN Richtig und EIN Falsch, ohne die Abermilliarden Zwischentöne, Grautöne und weiteren Zustände. Dann gäbe es EINEN RICHTIGEN Weg, EINE RICHTIGE STRATEGIE und EINE RICHTIGE Unternehmenskultur, mit klaren Maßstäben, eindeutigen KPI und vor allem einem EINZIGEN RICHTIGEN Weg all dies aufzubauen.
Das Problem: diesen so wunderbar einfachen Ansatz erlaubt die Welt uns nicht. 7,7 Milliarden unterschiedliche Menschen fordern ihren Tribut. Schon bei 2 Menschen beginnt das Chaos und manchmal brauche ich nicht einmal einen Zweiten dazu.
Und dennoch: Organisationaler Kulturwandel ist der Hit! Die Idee, endlich eine Kultur entwickeln können, die zum Unternehmen und zu den Menschen passt. Wie wunderbar das klingt. Die Zufriedenheit messen und steigern. Das Engagement erhöhen. Das Vertrauen zwischen MA, Führung und Organisation evaluieren und gezielt vergrößern. Klar, das muss man machen, denn Zusammenarbeit funktioniert mit zufriedenen, engagierten, vertrauensvollen, leistungswilligen, vielfältigen, kommunikationsstarken, resilienten, teamfähigen Mitarbeitern besser, das Unternehmen hat mehr Erfolg, macht mehr Gewinne und schafft sich gute Voraussetzungen, um auch in Zukunft im Markt attraktiv und aktiv bleiben zu können.
Im Grunde ist es ja in diesem Fall auch einfach zu erkennen, wo es im Unternehmen hakt, wie, wo und von wem, welche Werte nicht gelebt werden und so. Ebenso ist ja klar, woran das liegt, schließlich weiß man worum es geht, man kennt sich, die Kollegen und den Laden ja schon lange. Da ist es leicht zu verstehen, wie man das verbessern kann. Ja, und dann muss man ja nur noch machen.
So und prompt ist man in der Subjektivitätsfalle gelandet.
Klar weiß jeder, wo die Probleme liegen, klar weiß jeder, wie man sie lösen könnte und doch gibt es bei 20 Menschen 30 Meinungen und 40 Prioritäten.
Kultur ist relativ
Ohne jetzt total abzudrehen, aber für mich gibt es im Kontext Kultur ziemlich klare Analogien zu Einsteins Relativitätstheorie. Nicht nur das man die Energie im Unternehmen (E) als Gleichung von Menschen (m) hoch der Kultur (c) (zum Quadrat) darstellen kann.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen auf dem Weg zur Relativitätstheorie war es zu erkennen, dass die Beobachtung von Bewegung (Veränderung) abhängig vom Bezugssystem ist. Wer in einem Bahnhof in einem Zug sitzt, kann, wenn er durch das Fenster auf dem Nebengleis einen Zug vorbeiziehen sieht, nicht wissen, ob er selbst oder der andere Zug in Bewegung ist. Nur ein Beobachter von außen kann beurteilen, welcher Zug sich wie schnell bewegt. (Wobei, auch die Erde (Als Bezugssystem) mit dem Bahnhof und diesem Beobachter darin bewegt sich, genauso wie unser Planetensystem, unsere Galaxy und unser Universum…. )
Die Erkenntnis bleibt: Aus dem System heraus kann ich nicht wirklich erkennen, was das System in Bezug auf seine Umgebung macht – dazu muss ich weitere Parameter haben.
Kultur mit System
Als wenn das mit der Relativität nicht schon lästig genug wäre, kommt noch etwas hinzu. Systemtheoretisch betrachtet, verändert jeder, der in einem solchen System selbst aktiv ist, dieses System permanent, womit es sich wiederum selbst beeinflusst. Autopoesis nennt das der Systemtheoretiker.
Wir sind also nicht nur in „relativer“ Unkenntnis über den von außen betrachteten Zustand des Systems, wir verändern ihn gleichzeitig von innen, allein schon dadurch, dass wir ihn im Bewusstsein der Beobachtung beobachten. (Was erklärt, warum die „Kultur“ in der Gleichung der speziellen Kultur-Relativitätstheorie im Quadrat auftaucht: Komplex UND dynamisch im Fluss)
Wenn wir jetzt noch anfangen das System „Kultur“ auseinanderzunehmen, weil wir singuläre Erkenntnisse darüber besitzen, dass, zufriedenen Mitarbeiter leistungsfähiger sind (s.o.), dies versuchen zu messen und dann aus den Messergebnissen Maßnahmen ableiten, um das System damit zu verändern, dann… dann muss man schon viel Glück haben, um nicht aus Versehen an einer anderen Ecke Dinge zu verändern, die bislang gut gelaufen sind. So vorzugehen ist, aus meiner Sicht, eher ein Glücksspiel. Wobei – manche haben ja offensichtlich Glück…. Vielleicht ist es ja auch einen Versuch wert?!
Kultur ist im Fluss
Wenn jetzt also, „die Kultur“ relativ und systemisch ist und sich kontinuierlich verändert, wie soll man dann damit umgehen? Wie kommt man dahin, dass dieser sich ständig neu durch die weite Landschaft der Organisation mäandrierende Fluss sich auch nur ansatzweise in das Flussbett bewegt, das wir für ihn vorgesehen haben. Schließlich ist es das Ziel der Organisation, auf diesem Fluss Produkte und Services zu bewegen und an den Kunden zu verkaufen. Und dabei stört es ganz enorm, wenn der Fluss, die Kultur der Organisation, sich in 1.000 Seitenarme verästelt, sich isolierte Inseln bilden und gefährliche Strudel, Strömungen und Stromschnellen entstehen.

Seit geraumer Zeit kommt man wieder mehr dahin, Flüssen ihren natürlichen Lauf zurückzugeben und gleichzeitig für einen schiffbaren Bereich zu sorgen. Neben Schleusen werden Fischtreppen angelegt, die Abwässer sind inzwischen sauber, Schiffe werden aus der Luft überwacht und illegale Einleitungen werden streng geahndet. Ökologische Nachhaltigkeit ist hier längst als wichtiges Thema erkannt worden.
Dennoch haben wir nicht alles im Griff. Wenn die Regenmengen steigen, die Schneeschmelze zu schnell einsetzt, dann treten die Flüsse über die Ufer. Wenn die Gletscher irgendwann abgeschmolzen sind, werden sie zeitweise austrocknen. Flüsse sind von vielen Parametern abhängig, die sich unseres Einflusses entziehen. Wie die Kultur.
Und doch sind wir bei Flüssen, wie bei der Kultur, in der Lage vorauszuschauen und uns vorzubereiten. Wir wissen, wie hoch die Pegelstände sein werden, wir wissen, wann wir die Schifffahrt einstellen müssen oder wann nur noch mit halten Tonnage gefahren werden kann. Wir wissen, wie viel Last der Fluss verträgt.
Allerdings brauchen wir dazu komplexere Modelle, die mehr betrachten, als nur wie viele Kapitäne gerade glücklich über den Wasserstand sind. Wir brauchen mehr Informationen, als nur zu wissen, wie viele darauf Vertrauen, dass der Pegel es erlaubt mit dem aktuellen Tiefgang zu fahren. Wir brauchen mehr, als nur zu wissen, wer welche Waren in welchem Hafen erwartet.
Versteht mich nicht falsch, manchmal kann es hilfreich sein, sich nur auf einige Parameter zu konzentrieren, um ein singuläres Problem zu lösen. Häufig werden aber singuläre Erkenntnisse genutzt, um daraus mehr zu erklären, als sie an (komplexer) Information beinhalten. Dazu kommt, dass die Kollegen und Kolleginnen, die sich aus einem Unternehmen heraus, für dessen Kultur interessieren und engagieren, ja in diesem Fluss mitschwimmen. Sie haben also im übertragenen Sinn gar keine Sicht auf die zu erwartenden Regenmengen, können den Pegel an der nächsten Einmündung nicht messen und nur bedingt das Strömungsverhalten oder den Warenfluss beeinflussen.
Da sie im System sind, und damit immer nur aus dem System an ihm arbeiten können, fehlen die Möglichkeiten das Gesamtsystem unvoreingenommen von außen zu betrachten (was nur solange halbwegs funktioniert, wie das System nicht weiß, dass es beobachtet wird, denn dies sorgt zumeist für erste Veränderungen – Autopoesis – ich erwähnte es schon).
Um nicht vollständig den Bezug zur Außenwelt zu verlieren – und das ist ja weiterhin die Welt der Kunden, neuen Mitarbeiter, Wettbewerber und Investoren – braucht man auch den unabhängigen und objektiven Blick von außen! Wobei auch ein fokussierter Blick von außen der sich auf singuläre Ereignisse oder Artefakte beschränkt, immer nur singuläre Erkenntnisse zurückliefern kann. Die Herausforderung ist also das Unmögliche (weitestgehend) zu ermöglichen, d.h. das komplexe System in möglichst großem Umfang zu erfassen, ohne unseren Geist zu sprengen.
Und prompt ist es da: Das nächste Problem
Der Heilsbringer scheint also jemand zu sein, der von außen auf das Gesamtsystem blickt. Jemand, der es beobachtet, die Beobachtungen interpretiert und daraus Maßnahmen, Vorschläge ableitet. Das Problem: Er (oder Sie) kann damit im Grunde nie richtig liegen, denn es fehlen die Erfahrungen, Wahrnehmungen und Erkenntnisse aus dem Inneren des Systems. Die Außensicht muss daher immer mit der Innensicht gemeinsam genutzt werden!
So stellt sich die eigentlich ganz banale Frage: Wie macht man das, wenn doch die Kommunikation der Erkenntnisse aus der Außenbetrachtung das System in sich beeinflusst?
Meine Erfahrung: Gar nicht!
Allein von innen oder von außen das System zu betrachten, egal, wie geschickt man sich dabei anstellt und egal wie umfassend die Betrachtung auch ist: Es kann nicht gelingen daraus wirklich Maßnahmen abzuleiten, die dem System helfen, sich im Vergleich mit einem Bezugsystem gezielt zu verändern.
Was bleibt ist ähnlich banal und zugleich schwierig: Natürlich ist der Weg, die innere und äußere Wahrnehmung geeignet zu kombinieren, d.h so zusammenzuführen, dass das innere gespiegelt wird, ohne vom äußeren verzerrt zu werden. Man muss also versuchen, um zum Fluss zurückzukehren, das Wasser zu verlassen, ohne das Wasser zu verlassen und zugleich einen neuen Blickwinkel einzunehmen.
Zum Glück gibt es wasserfeste Displays
Stellt euch vor, ihr schwimmt im Fluss und bekommt dann die Erkenntnisse der Außenperspektive auf einem wasserfesten Display zu sehen. Stellt euch vor, ihr könnt euch dazu mit anderen austauschen und, bei Bedarf, jemanden Fragen, der die Darstellung der Außenperspektive deuten und erklären kann. Stellt euch vor, ihr bekommt die Chance gemeinsam mit anderen zu interpretieren, zu schlussfolgern, zu verstehen, was die Außenwelt so sieht. Und das in voller Kenntnis eures eigenen Systems.
Was dabei passiert: Selbsterkenntnis. Wer so hingeleitet wird sich selbst, als Organisation, aka System, (neu) zu betrachten, der erkennt mitunter plötzlich, was schief liegt, welche Rituale und Traditionen das Zusammenspiel fördern und welche es behindern. Der erkennt, welche Wirkkreise existieren und warum die Diskussion der Strategie dazu führt, dass der Kaffeekonsum steigt und die Kickertische weniger genutzt werden, ‚obwohl‘ alle noch zufriedener und resilienter sind als zuvor.
Was tun?!
So – und jetzt sagt ihr mir: „Das ist mir zu kompliziert.“ Stimmt nicht! Es ist zu komplex (Klugscheißermodus wieder aus).
Also, was kann man tun?
- Verzweifeln! Ich meine das ganz im Ernst. Wer nicht (Ver)Zweifelt macht nunmal mit dem weiter, dass bislang (nicht wirklich 100%) erfolgreich war. Also, bitte, lasst Zweifel zu.
- Macht euch klar, worum es wirklich gehen soll. Wollt ihr das System verstehen oder nur an ein paar Stellschrauben drehen. (Um noch einen Analogie reinzubringen:) Wenn der Motor nicht rund läuft, dann hilft es oft (bei den alten Motoren) den Vergaser anders einzustellen. Dann geht’s erstmal. Dass die Zündkerzen runter gebrannt sind, ist dann für die nächsten Kilometer noch zu verschmerzen.
- Macht euch die möglichen Ursachen von Problemen bewusst. Zurück um Motor bedeutet das: Er läuft nicht rund, das kann am schlechten Sprint liegen, an den Zündkerzen, am Vergaser, am Öl, an defekten Kolben, der Nockenwelle, den verschobenen Zündzeitpunkt, kaputten Kabeln, …
- Die Symptome sind ähnlich, die Ursachen können grundverschieden sein. Das ist schon bei Motoren mitunter das Problem.
- Schaut euch den jeweiligen Status Quo der Ursachen an. Vergesst die Symptome! Prüft die Zusammenhänge und Abhängigkeiten.
- Und dann: nehmt die richtigen Hebel in die Hand. Schmiert den Bowdenzug des Choke, damit ihr nicht bei Volllast weiterhin zu viel Sprit in die Brennkammer jagt. Ups, diese mögliche Ursache hatte ich oben ja gar nicht aufgeführt.
So, jetzt läuft der Motor wieder, aber was ist mit der Kultur, mit dem Vertrauen, der Zufriedenheit, dem Engagement, der produktiven Energie, der Gelassenheit, der Stabilität, der Sicherheit…?
Vielleicht wisst ihr ja nicht einmal, welche Ursachen alles in Betracht kommen?
Bei manchen Kulturwandelprojekten fehlt diese grundlegende (Er)Kenntnis der Ursachenebene. Sie sind unbewusst aus dem Zusammenhang gerissen. Sie betrachten das System aus den bequemen, weil gut beobachtbaren Blickwinkeln. Sie suchen den Schlüssel unter der Laterne, weil dort Licht ist.
Wofür ich mit all dem plädieren möchte:
Nehmt Kultur trotz und wegen ihrer relativistischen Systemik in möglichst großem Umfang wahr ohne davon Angst zu bekommen. Versucht die Dinge umfassend zu betrachten, ohne davon überwältigt zu werden. Nutzt Außenanalysen, die bewusst keinen Projektvorschlag und keine Lösung beinhalten (Also verzichtet auf Angebote, die damit werben, die Lösung schon mitzubringen: „wahrscheinlich ist das Problem die Zufriedenheit, also messen wir das mal und dann bauen wir die Kickertische auf“).
Lasst euch darauf ein, den Weg zu starten, ohne ein Ziel, eine Lösungsdauer und ein Budget dafür zu kennen. Und vor allem: Glaubt nicht, was ihr aus der Innenperspektive wahrnehmt. Sonst kann es sein, dass ihr glaubt, dass euer Zug in voller Fahrt ist, dabei bewegt sich gerade der Bahnhof…
Messt nicht, was ihr schon kennt, weil ihr es schon kennt, sondern entwickelt Offenheit und Verständnis gerade für die Dinge, die ihr niemals für möglich gehalten hättet – auch im Kontext Kultur.
Und – ja klar arbeite ich selbst, wie alle diagnostischen Mentoren von AGILITYINSIGHTSgenau so!
05.09.19 | Blog, Leadership / Führung, Management, Zusammenarbeit |
Jetzt, so kurz nach den Ferien wünscht sich mancher zurück an den Strand, in die Berge. Manche wollen zurück in den Naturpark, andere neue Städte kennenlernen, neue Kulturen, andere Menschen. So träumt so mancher davon einfach dableiben und vom Urlaubsort auch arbeiten zu können.
Aber auch neben dieser romantischen Darstellung ist Telearbeit, Remote Work oder das Home Office – egal welchen Namen wir dem Kind auch geben – ein zunehmend wichtiges Aspekt der Zusammenarbeit. Und das nicht nur, weil diese Art der Arbeit durch weniger arbeitsbedingtes Pendeln und Dienstreisen Lebenszeit spart und die Klimabelastung verringert.
Es gibt viele gute Gründe und Ansätze dafür, die ich u.a. in einer inzwischen 5 Jahre alten, aber im wesentlichen noch immer aktuellen Präsentation zusammengetragen habe. Wer mag, kann gerne mal reinschauen.
Doch, das zu bohrende Brett ist in Deutschland noch ziemlich dick. Dennoch gebe ich nicht auf. Auch wenn einige große Unternehmen gerade versuchen ihre Mitarbeiter wieder zurück in die Büros zu bekommen, ich bin überzeugt, dieser Versuch wird nur teilweise gelingen.
Zu wichtig ist es in und für die Zukunft aus Unternehmenssicht attraktive Möglichkeiten zu schaffen, denn, unabhängig davon, ob es sich um ein Generationen-, Kultur- oder Führungsthema/-problem handelt, der Arbeitsmarkt wird enger, die Chancen bei einem interessanten Arbeitgeber zu arbeiten bestehen für die brauchbaren und vor allem die sehr guten (Wissens)arbeiter tatsächlich weltweit. Unternehmen müssen darauf reagieren.
Welchen Weg Unternehmen gehen, remote wird im großen oder im kleinen Stil immer dabei sein müssen. Entsprechend ist die technische und sozial-fachliche Kompetenz gefordert, dieses „neue“ Zusammenspiel für alle sinnvoll zu gestalten und zu leben.
Ich werde mich hier auf den Führungsbereich in solchen „remote“ Situationen, neudeutsch auf „Remote Leadership“ fokussieren. Sehr gute technische Lösungen sprießen jeden Tag neu aus dem Boden. Ich habe selbst viele davon ausprobiert. Aber die Technik ist nicht mein Spezialbereich, da gibt es viele Anbieter, die das besser können. Zum Beispiel stellt Communardo solche Lösungen, samt typischer Anwendungsszenarien, auf dem Digital Workplace Summit am 13. November in Hamburg vor, bei dem ich die Keynote halten darf. Dabei geht es dann um „Zusammenarbeit stinkt vom Kopfe her. Warum und wie wir Management & Führung neu denken müssen, damit Zukunft funktioniert.“ Noch gibt es Tickets. 😉
Zurück zu remote leadership
Das Spannende an Remote Leadership, ist, dass es nicht nur im die bi-/multilaterale Beziehung einiger Menschen geht, sondern das es Auswirkungen auf die gesamte Organisation hat. Konkret: Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit Remote Work (und Leadership und Collaboration) funktioniert.
Das Ergebnis der Arbeit von Menschen mit Menschen ist immer wieder auch Arbeit in, an und mit einem komplexen System. Um das systematische etwas aufzubrechen, es „unkomplexer“ beschreiben zu können und mit etwas Struktur zu umgeben, orientiere ich mich am CoRE-Canvas (CoRE = Collaboration Reframing & Evolution) der mit 15 Fokusbereichen gute Hilfestellung gibt. Dennoch werde ich am Ende ein paar Ergänzungen machen und dennoch insgesamt höchstens die Spitze des Eisbergs anreißen können. (Vielleicht lohnt es ja, das Thema auf anderen Wegen zu vertiefen?!)
Als Führungskraft, ob in einer remote oder „on-site“ Situation, blickt man immer drei Kernfragestellungen ins Auge:
- Was muss fachlich getan werden, damit die Mitarbeiter ihren Wertbeitrag optimal, ins Team und die Organisation einbringen können und wollen(!).
- Was brauchten die Mitarbeiter dafür und wie sieht die menschlich soziale Seite der Arbeit am gemeinsamen (!) Ziel aus?
- Welche Organisationsstruktur und welche Rahmenbedingungen sind dazu notwendig?
Bei all dem steht eine Frage noch über allen anderen im Raum: Was hindert uns daran, eine für alle möglichst perfekte Arbeitsbeziehung und -umgebung aufzubauen?
Soviel zum Rahmen, in dem ich mich heute bewegen werde.
Doch jetzt zu den 15 Fokusbereiche, von denen jeweils 5 auf eine der drei Kernfragestellungen einzahlen, daher bitte nicht über die Reihenfolge wundern. 😉
Fähigkeiten
Als „remote leader“, in räumlicher Distanz zu zumindest einem Teil der Mitarbeiter, ist es im Vergleich zu einer on-site Situation noch wichtiger die Fähigkeiten der Mitarbeiter „da draußen“ zu (er)kennen, gezielt einzusetzen und ihnen Raum für deren Weiterentwicklung zu geben. Ich muss mir also zuerst ein Bild und eine Übersicht verschaffen. Damit alle gemeinsam möglichst effektiv arbeiten können, sollten die Fähigkeiten, das Wissen und die gegenseitigen Lernmöglichkeiten (aber dazu komme ich später noch einmal), transparent allen leicht zugänglich sichtbar gemacht werden. Um nicht klassische Kompetenzdatengräber zu fördern, halte ich z.B. ein Online Photoalbum, in dem jeder Fotos von sich bei den zu den Fähigkeiten passenden Tätigkeiten ablegen kann (ja, gerne auch mit etwas Text) für eine spannende Idee.
Allein daran lässt sich ablesen: Nicht nur die Fähigkeiten an sich sind wichtig, sondern auch der Austausch darüber. Er ist der erste Baustein um, trotz einer verteilten Teams, einfach neue Ideen zu entwickeln und voranzubringen. Die Möglichkeit zum Austausch über die Fähigkeiten ist nicht nur aus fachlicher, sondern auch aus sozialer Sicht enorm wichtig.
Austausch
Wenn das Team überall im Land oder der Welt verteilt sitzt, dann fallen naturgemäß die Kaffeeküchengespräche und informelle Mittagessen weg. Um so wichtiger ist es dennoch eine gute Basis für einen regelmäßigen und umfassenden Austausch zu fachlichen (und anderen!) Themen zu schaffen. Ob man dies in täglichen „Morning Alignments“, in wöchentlichen Statusrunden oder in einer anderen Form macht, ist dabei ziemlich egal, nur eines ist nicht egal: Die Zeit darf nicht als verschwendet angesehen werden dürfen! Gerade remote ist (und passiert) es leicht, dass die Aufmerksamkeit (ab)wandert. Also: eine klare und aktuelle Agenda (ja, auch für regelmäßige Treffen!) mit relevanten Themen, die tatsächlich alle (oder fast alle) interessieren ist um so mehr Pflicht!
Das zweite ebenso relevante Thema, wie die persönlichen individuell wahrgenommene Relevanz des Austauschs, ist die genutzte Plattform. Ich selbst habe unzählige Messenger und Videocall Plattformen ausprobiert. Einige gute und viele schlechte. Nichts ist schlimmer als ein Tool, das zwar als goldeierlegende Wollmilchsau daherkommt, aber so kompliziert ist, dass kein Mensch es gerne, einfach und schnell man zwischendurch nutzen möchte. Es sollte einladen, es auch dann zu nutzen, wenn man sich neben und außerhalb der Arbeit mit den Kollegen austauschen will – überhaupt sollte auch dazu immer wieder Zeit und Gelegenheit geben. Das fördert die Beziehungstiefe und die Vernetzung – zwei enorm wichtige Punkte für ein gut funktionierendes remote (und Hochleistungs-)Team.
Austausch sollte auch nie „nur remote“ sein. Für gute Beziehungen (zu denen komme ich nachher auch nochmal ausführlicher) ist es wichtig den anderen gesehen, gespürt, gerochen, einfach mit (den meisten) Sinnen wahrgenommen zu haben. Gestik, Mimik und Stimme lassen sich schon über Distanzen übertragen, jemandem die Hand zu geben und gemeinsam einen Weg zu gehen ist dennoch noch etwas anderes.
Ein letzter Punkt – der mir, wer mich kennt weiß das, selbst immer wider schwerfällt: small talk. Für eine emotional stabile (Ver)Bindung ist gerade auch die Möglich- und Gelegenheit, sich mal entspannt über alles mögliche zu unterhalten, wichtig. Das schafft das enorm gute Gefühl von Zusammenhalt – zumindest, wenn die Gesprächspartner in ihrem Talk nicht zu small werden.
Und ein allerletzter Punkt: big talk… Was das ist? Es ist meine Umschreibung dafür, dass es auch mal notwendig ist Dampf ablassen zu können. Nicht nur im Verborgenen, sondern ganz offen mit den Kollegen. Auch dafür muss Raum gegeben sein.
Chancen
Wer fern ab von „der Zentrale“ sitzt, fühlt sich schnell auch ausgeschlossen. Chancen, die anderen durch den schnellen direkten, informellen Dienstweg, weil jemand gerade am Schreibtisch vorbeikommt, oder weil mal durch den Flurfunk von dem neuen Projekt oder der neuen Stelle erfährt, leicht nutzen können entgehen einem fast immer. Man ist nicht zu präsent und damit aus den Augen und aus dem Sinn.
Doch wie sieht es mit den Chancen aus, die für alle gemeinsam relevant sind? Chancen, die sich auch remote leicht nutzen lassen und die man vielleicht forcieren kann? Es geht um Raum für Innovation, für Ideen und gemeinsame Herausforderungen. Die schaffen nicht nur ein Gemeinschaftsgefühl, Herausforderungen wie „remote Fed-Ex Days“ (Man muss mit dem Team innerhalb von 24 aus Ideen einen Prototyp entwickeln – in einem remote Setting besonders herausfordernd) oder andere Challenges, die es gemeinsam zu meistern gilt, können Booster für neue Produkte sein. Ein guter Leader stimmt diese Herausforderungen auf sein Team und dessen Fähigkeiten ab.
Wirksamkeit
Wo oftmals schon die Kommunikation unter der Entfernung und ggf. unterschiedlichen Arbeitszeiten leidet, da ist die Aufgabe ‚Wirksamkeit‘ sichtbar und erfahrbar zu machen, eine besondere Herausforderung. Besondere Leistungen, und manchmal auch die ganz normalen, brauchen Aufmerksamkeit, denn – nein – sie sind nicht unbedingt selbstverständlich. Wieder ist auf der Beziehungsebene wichtig zu erkennen, wer welche Art von Feedback oder Freiraum braucht und wem es hilft, den Fokus der aktuellen und langfristigen Arbeit mit anderen zu reflektieren um mehr (Selbst)Wirksamkeit zu entwickeln. Eine Aufgabe, die, gerade bei verteilten Arbeitsorten und -zeiten, viel Zeit in Anspruch nehmen kann, die sich aber immer lohnt. Daneben stellt sich die Frage, welche KPI dem Team helfen sich seiner eigenen Wirksamkeit bewusst zu werden und wie bzw. wo diese zusammengetragen und dargestellt werden. Ein direkter Bezug zum individuellen Wertbeitrag und der gemeinsamen Wertschöpfung ist auch hier wichtiger als in on-site Settings.
Wer selten in ganz direktem Kontakt zueinander ist, wer nicht unmittelbar mitbekommt, was, wer, wo, wann macht, der kann auch den wirksamen Einsatz von Ressourcen schwerer einschätzen. Auch hier sind offene, transparenzschaffende Dialoge alles andere als Zeitverschwendung.
Wer oft „im stillen Kämmerlein“ vor sich hinarbeitet, verbeißt sich manchmal in Aufgaben, die aus der Distanz als weniger wertschöpfend wahrgenommen werden. Daher sollten immer wieder auch die, ggf. unterschiedlich wahrgenommenen Prioritäten angesprochen werden. Vor allem Ziele und Erwartungen sollten deutlich klarer an- und ausgesprochen werden, als on-site, wo immer mal sichtbar wird, wer woran wie intensiv arbeitet.
Wertbeitrag
Ziele und Erwartungen… die liegt der Wertbeitrag nicht fern. Das Thema ist, welche individuellen Wertbeiträge diejenigen sind, die auch für das Team besondere Relevanz besitzen. Wieder ist glasklare Kommunikation gefragt. Doch strikte Vorgaben sind hier (noch mehr als sonst) kontraproduktiv. Remote findet sich immer ein Fluchtpunkt, um an den Dingen zu arbeiten, die als persönlich wichtigen angesehen werden. Diesen Raum sollte ein „remote leader“ schon im Vorfeld schaffen. Er ist das Vorzimmer für mehr Emergenz und genau die ist es, die es vor allem remote zu fördern gilt, denn auf ihr beruht letztendlich der Erfolg des Teams. Doch: Die Emergenz bedeutet auch Abhängigkeiten – im Team und darüber hinaus. Diese sollten, nein, diese müssen allen klar sein.
Der Wertbeitrag ist der Zwilling der Wertschätzung, ignoriert man den einen, fliegt einem der andere um die Ohren. Man sollte also sehr genau hinschauen, wo Wert für die Organisation entsteht und wer dafür die Lorbeeren einstreicht.
Ziele
Wer bei der Zusammenarbeit auf Distanz bleibt, muss ein klares gemeinsames Verständnis für die zu erreichenden Ziele schaffen. Der sonst so informative wie normative Austausch am Schreibtische oder in der Kaffeemaschine fällt hier weg, weshalb es um so wichtiger ist, Ersatz zu schaffen. Ein guter Weg ist Raum und einen festen Platz für Fragen (jeder Art!) zu schaffen. Ein Onlineboard oder eine Messenger Channel hilft, sich abzustimmen und nebenbei den/die anderen besser einschätzen zu können. Gute remote Leader füttern dieses Fragenpanel immer wieder mit geeignete Impulsen, um die Dialoge zu Zielen, Vision, Werten und zur Kultur in Gang zu halten.
Noch deutlich stärker als in on-site Settings, sollten die Ziele handlungsleitend strukturiert, formuliert und verstanden werden (können). Damit diese Ziele dann beim weit entfernten Gegenüber auch ankommen, sollten sie mit den persönlichen Zielen harmonieren. „Remote“ gibt es sonst gar keine Chance, dass engagiert an diesen Zielen gearbeitet wird, zumal klassische Druckmittel, wie der stetige, kontrollierende Blick über die Schulter naturgemäß wegfallen. Freiwilligkeit und Selbstmotivation sind remote einfach existenziell. Das macht wiederum klar, dass die Ziele ein wichtiges Kriterium erfüllen müssen: Sie dürfen den Kollegen in dessen Freiheit des fernen und vielleicht selbstgewählten Arbeitsplatzes nicht einengen.
Beziehungen
Eine Beziehung am Arbeitsplatz… ohoh. Auch wenn, nein, weil der Begriff bei den meisten etwas anders besetzt ist, wähle ich ihn bewusst. Tragfähige soziale Beziehungen und Verbundenheit sind bei verteilten Arbeitsorten besonders wichtig. Der bedeutendste Aspekt darin: Vertrauen. Wo durch die Distanz schon der Boden sehr kräftig mit Dünger für Misstrauen vorbereitet ist, sind vertrautenschaffende Handlungen und Haltungen von ganz besonderer Relevanz! Dazu gehört der gemeinsame Wertekodex genauso wie die ungeschriebenen, bewussten und unbewussten Annahmen darüber, wie etwas zu sein hat und wie es getan werden sollte. Und wieder sind Dialoge das Mittel der Wahl, wo Kontrolle einfach nicht machbar ist. Um den Aufbau von Vertrauen zu erleichtern, hilft es, Identifikationspunkte zu schaffen. Die Identifikation mit der Aufgabe, dem Team, dem gemeinsamen Ziel und der Organisation insgesamt, gespeist aus einem Bewusstsein für die Leistungen der Vergangenheit und die Perspektiven in der Zukunft, schafft ein starkes Fundament auf dem die Zusammenarbeit leichter funktioniert.
Um einen starken Identifikationspunkt im Team selbst zu schaffen, gibt es noch einen weiteren Ansatz: Findet „uncommon communalities“ also außergewöhnliche Gemeinsamkeiten und betont diese. Und sei es, dass alle aus einem kleinen Dorf stammen oder lieber remote statt zusammen mit anderen im Büro arbeiten. Sind solche Punkte bekannt und bewusst, bringen sie auch ansonsten Fremde verblüffend schnell zusammen.
Doch, so nett und bequem oder auch notwendig es sein mag, an verschiedenen Standorten zu arbeiten: Immer wieder ist es notwendig zusammenzukommen. Gemeinsame Erlebnisse, der Austausch jenseits der Arbeit (s.o.), die Gespräche beim Wein und/oder Bier, das buchstäbliche er-fassen des anderen sind nicht zu unterschätzende Momente, wenn es darum geht gute Arbeitsbeziehungen aufzubauen. Eine Aufgabe die nicht nur Führungskräften obliegt, sondern eine Aufgabe für jeden!
So gut die Beziehungen auch sein mögen, immer treten auch Konflikte auf. Konflikte, die sich um so mehr aufschaukeln können, je weiniger man mit dem anderem im direkten Kontakt und Austausch steht. Schnell sind die inneren Abwehrmechanismen aktiviert und die Konfliktparteien vergrößern die ohnehin große Distanz. Hier ist (wieder) Leadership und bereits im Vorfeld hohe Aufmerksamkeit gefragt.
Lernen
Wenn in einem weit verteilt arbeitenden Team, jeder seine, ja oftmals noch deutlich vielfältigeren Erlebnisse, Erfahrungen und Informationen frei und leicht einbringen kann, dann wächst da eine unglaublich breite Basis für gemeinsames und gegenseitiges Lernen. Nie war der Austausch in diesem Kontext so einfach wie heute. Nie war Peer-Learning wichtiger. Hilfreich ist dabei das Wissen auch für diejenigen verfügbar zu machen, die in dem Moment des Austauschs nicht dabei sein konnten, was leicht fällt, wenn man ohnehin online ist. Blogs, Podcast und Vlogs sind die perfekten Tools, um Wissen zu transportieren und zu diskutieren.
Jenseits des internen Austauschs sollten alle möglichen anderen Lernerfahrungen ermöglicht werden, einerseits als Geste der Wertschätzung, andererseits, um die Autonomie und damit die Selbstverantwortung sicht- und spürbar zu machen und mehr Verbundenheit zum Team und dem Unternehmen zu schaffen.
Autonomie
Autonomie hab ich jetzt schon ein paarmal erwähnt. Wer weit weg ist, braucht sie, um überhaupt arbeiten zu können – je intensiver Kopf und Kreativität dabei gefragt sind, desto mehr. Dabei ist Autonomie keine logische Folge von remote work. Sie muss gegeben und angenommen werden – von beiden Seiten, in beide Richtungen. Damit die Zusammenarbeit aber wirklich gut funktionieren kann, braucht sie auch ihre Grenzen – sonst wird auch hier aus Autonomie zu schnell eine sehr schädliche Anarchie. Ein paar Basics müssen also in jedem Fall vereinbart werden, etwa wann man für andere erreichbar ist (und wann nicht) oder wer, wann, was frei entscheiden kann und welche Entscheidungsprozesse überhaupt genutzt werden sollen und können. Je klarer hier der individuelle Freiraum und dessen Grenzen definiert sind, desto besser.
Wertschätzung
Auch Wertschätzung hatte ich hier schon ein paar mal erwähnt. Wichtig ist sie ohne Frage, aber im Grunde auch nicht so schwer zu realisieren, zumindest, wenn man seinen Blick ein wenig dafür trainiert, die mit den Aktivitäten verbundenen Aufwände anderer zu erkennen. Wenn es dann noch gelingt, diese auch nach außen sichtbar zu machen, dann ist schon viel gewonnen. Allerdings muss dieser Blick auch weit genug gehen, denn niemand, so unbedeutend die Rolle zunächst auch wirken mag, will und sollte vergessen werden. Vor allem, wenn das Team gut untereinander vernetzt ist und viele Aktivitäten „einfach so“ laufen, wird es schwer zu erkennen, wer besonders geschätzt werden sollte. Da hilft es Online Kudos oder auch kleine Peer-to-peer Belohnungen zu ermöglichen. Wertschätzung ist schließlich keine ausschließliche Führungsaufgabe – im Gegenteil!
In der gegenüberliegenden Ecke von Wertschätzung wird es dagegen manchmal schwierig und das ist dann definitiv eine Führungsaufgabe: Es geht um den Neid, der manchmal, insbesondere in Strukturen in denen es sowohl on-site als auch remote Arbeitssituationen „nebeneinander“ gibt, auftaucht. Die Frage: „Wieso darf der (oder die) das und wieso muss ich hier weiter ins Büro pendeln“ sollte immer bereits im Vorfeld beantwortet werden. Nichts ist schlimmer, als in der Ferne bewusst ausgegrenzt zu werden.
Immer wieder bewusste sichtbar gemachte Wertschätzung kann einem andern Phänomen von remote work entgegenwirken: dem „aus den Augen, aus dem Sinn“ und der damit verbundenen unbewussten Ausgrenzung.
Strategie & Prozesse
Wenn es um die Ausgestaltung der Zukunft und die Optimierung der Gegenwart geht, wenn also Strategien festgelegt und Prozesse angepasst werden sollen, ist auch, wieder mal eine glückliche Hand im remote leadership gefragt. Wieder geht es um zielgerichtete und aktive Kommunikation, um die An- und Einsichten der so entfernt sitzenden, aber unmittelbar Beteiligten einzuholen. Das ist eine Bring- und keine Holschuld! Gerade, wenn Prozesse angepasst werden, bedürfen die besonderen Eigenheiten von remote Situationen besonderer Beachtung. Etwas, dass über die offizielle Interessenvertretung – den remote leader – eingebracht werden sollte, den noch ist es oft so, dass solche Veränderungen nur im (zu) kleinen Kreis initiiert und beschlossen werden.
Auch wenn Strategien und (Entscheidungs-)Prozesse on-site anders aussehen und strukturiert sind als remote, ist ein bewusstes Vorgehen gefragt. Vor allem in remote Situationen ist kein Raum für sinnbefreite Abläufe und Bürokratie. Hier fallen solche lästigen Zeiträuber auf wenig nahrhaften Boden und sollten ohnehin im allgemeinen Interesse überdacht und vor allem überarbeitet werden.
Beteiligung
Jemanden intensiv am Geschehen in der Organisation zu beteiligen, der selten sichtbar und fast nie physisch präsent ist, ist eine echte Herausforderung. Doch gerade dann ist diese Beteiligung, das Gefühl „mittendrin statt nur dabei“ zu sein, besonders wichtig!
Daher ist die wichtige Aufgabe eines remote leaders nicht nur selbst den Kontakt zu pflegen, sondern die „entfernten“ KollegeInnen auch immer wieder den anderen in der Organisation vor Augen zu führen und zu Ohren zu bringen.
Auch und gerade, wenn viel Kommunikation gemeinhin über den Flurfunk stattfindet, ist es wichtig, z.B. die Hintergründe und die Zielsetzung von Entscheidungen verfügbar und (intern) öffentlich zu machen. Nur dann, mit einem klaren Verständnis für die Beweggründe, kann remote auch wirklich danach gehandelt werden.
Andererseits kann die Einbindung in die Organisation erleichtert und verbessert werden, wenn ganz bewusst Aufgaben, die die gesamte Organisation betreffen, von remote agierenden Teams angegangen und gelöst werden. Gerade, wenn dazu auch andere, sonst nicht im Fokus der remote Teams stehenden Bereiche der Organisation eingebunden werden müssen, stärkt dies die Beziehungen und Verbundenheit.
Struktur
Wenn es irgendetwas gibt, was remote wirklich nutzlos ist, dann sind es veraltete Organigramme. Überhaupt sind Org-Charts Relikte einer wohlstrukturierten Zeit. Wenn man die Veränderungen im Unternehmen nicht selbst sieht, miterlebt und versuchen soll, sich anhand solcher Informationen durch das Unternehmen zu hangeln, dann ist dies aktive Zeit( und Geld)verschwendung. Wichtig hingegen ist eine Übersicht über die aktuellen und meist informellen Netzwerkstrukturen, die tatsächlich wiedergibt, wer, wann, wo mit wem arbeitet, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Klar, es ist (wieder) eine besondere Herausforderung diese zu erstellen und up to date zu halten, aber das Thema anzugehen lohnt immer (egal ob man remote oder on-site zusammen arbeitet).
Und auch hier gilt, wie bei den Prozessen: So schlank wie möglich, so groß wie nötig.
Sicherheit
Wer fern ab vom übrigen geschehen des Unternehmens sitzt und wenig bis gar nicht in die Entwicklungen einbezogen ist, der kann schnell aus Mücken Elefanten wachsen sehen. Unsicherheit ist einer der Faktoren die Leistungsfähigkeit stark einschränken. Sie zu verringern ist eine der wichtigen Aufgabe im Kontext von remote Leadership.
Das betrifft auch Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung und der eigenen Performance, schließlich fehlt ja oft die direkte Vergleichsmöglichkeit. Zumal diese Transparenz (wieder) ein wichtiger Baustein ist, um Vertrauen auf- und Misstrauen abzubauen.
Eine Gefahr lauert darin Sicherheit geben zu wollen, wo vielleicht gar nicht soviel Sicherheit ist: Kleine (Not)Lügen und der Verlust der Ehrlichkeit. Das sollte man niemals riskieren! Ehrlichkeit im Umgang miteinander ist, so leicht es auf die Distanz fällt sie zu umgehen, so wichtig ist es eben auch dieser Versuchung zu widerstehen!
Ein oft, auch in on-site Settings, unterschätzes Element, ist die Missachtung oder sogar der Missbrauch von Werten und Vereinbarungen. Wer hier nicht aufpasst riskiert die Zusammenarbeitskultur massiv zu untergraben. Auch das ist daher ein wichtiger Aktivitätsbereich eines remote leaders.
Wertschöpfung
Was, wer, wie an Wertschöpfung beisteuert und wie aus dem gemeinsamen Emergenz und echter Mehrwert für das Unternehmen entsteht, ist, wie so viele Dinge, die remote schwieriger ab- und einzuschätzen sind, besonders wichtig transparent zu machen. Aber auch, wenn nicht alles in feierbaren Erfolgen endet, sondern auch, wenn furchtbare Misserfolge produziert werden, ist diese negative Wertschöpfung Resultat des Versuchts etwas positives für das Unternehmen zu erreichen. Daher darf auch hier eine positive Wertschätzung dieses Versuchs nicht fehlen! Insbesondere, weil auch diese Misserfolge Anlass geben können daraus zu lernen und die Chancen für eine positive Wertschöpfung in Zukunft zu verbessern.
Hinzu kommt: Schon in klassischen on-site Unternehmen fällt es den meisten Mitarbeitern schwer die Wertschöpfungskette vollständig nachzuvollziehen. Nicht nur ich sehe das immer wieder kritisch.
Allgemein
Vieles, was ich hier beschrieben habe gilt sowohl in on-site, wie auch in remote Arbeitssituationen. Vieles hat aber remote eben auch eine besondere, oftmals größere Bedeutung, wie zum Beispiel eine wirklich eindeutige, klare und einbindende Kommunikation.
Was ebenfalls immer gilt, wen sich Menschen einem Leader anvertrauen, um gemeinsam ein Ziel zu verfolgen ist, dass wir alle sehr unterschiedlich in unserem Wesen, unseren Ansprüchen und Erwartungen sind. Wer Führung übernehmen will und als Leader Menschen anregen möchte zu folgen, der sollte dies berücksichtigen. Vielfalt ist ein Schlüssel, der das richtige Schloss braucht, um seien Wirkung voll zu entfalten.
Bevor ich schließe noch drei Impulse zum Thema (remote) Leadership:
- Je mehr eine Leader die Annahmen besitzt, dass sein Team zu großartigen Leistungen fähig ist, desto mehr wird das Team dieser Erwartung auch gerecht (auch wenn das sonst nicht unbedingt der Fall wäre). Dieser Effekt wurde ich vielen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. Sieh dein Team also als stark und für alles gerüstet an und es wird genau das sein.
- Führen durch Fragen und Hinweise, also durch das was man als „powerless communication“ umschreibt, funktioniert besser als Resultate vorzugeben und einzufordern – gerade in Aufgabenbereichen jenseits von Routinen. Fordere also weniger und lade lieber durch Fragen ein, Dinge anzugehen und zu tun.
- Und das betrifft die ganz persönliche Außenwirkung der Führungskraft: Teams von Leadern, denen es gelingt, wie oben beschrieben zu führen, sind leistungsstärker und es liegt daher nah dies immer wieder durch ein „wir“ in der Kommunikation zu betonen. Führungskräfte werden dann aber von Außenstehenden als schwächer wahrgenommen. Noch immer zählt (fataler- und fälschlicherweise) auf der Karriereleiter das „ich“ mehr als das „wir“. Aber auch das kann man ja mit der Zeit ändern.
Wenn du noch weitere Aspekte von „remote leadership“ betrachten und diskutieren möchtest, dann bist du herzlich eingeladen dies mit meinen freiKopfler Kollegen Christoph Karsten, Heiko Bartlog und mir in unserem nächsten kostenfreien Webinar am 18.09. um 15:00 zu tun.
Wenn du deutlich mehr in die Tiefe gehen und die Dinge ausprobieren möchtest, dann solltest du überlegen, dies mit uns beim „Future Leadership“ Seminar im nächsten Jahr zu tun. Zu den Terminen und zur Anmeldung geht es hier.
Und damit zur letzten Frage: Hast du schon einmal darüber nachgedacht, diese Themen in deinem Unternehmen offen mit einem externen Sparringspartner zu diskutieren, um schnell und organisationsindividuell damit weiterzukommen?
HINWEIS
Wenn du herausfinden möchtest, wie gut die Basis für die Zusammenarbeit, egal ob in einem remote oder on-site Setting, (bereits) entwickelt ist, dann nimm an meiner Umfrage teil. Du erhältst (meist innerhalb von 24 Stunden) Deine individuelle Auswertung.

21.08.19 | Blog, CoRE, Leadership / Führung, Management, Management Insights, Organisationale Agilität, Organisationsgestaltung |
Perspektive & Impuls
In der letzten Woche habe ich die, vor allem indirekten Kosten im Kontext Agilität thematisiert. Einen Bereich hatte ich eher unbewusst ausgespart. Einen Bereich, der in den Diskussionen der letzten Tage jedoch (wieder) sehr zu Tage trat und vielleicht wie kein anderer zum Wechselspiel der Gefühle rund um Agilität beiträgt. Es geht um die Kosten, die durch die starke Verunsicherung entstehen, die die Entwicklungen in Richtung agilerer Organisation(seinheit)en oftmals auf allen Ebenen mit sich bringen. Eine Verunsicherung die, mit Ausnahme einer weniger, die Masse der Beteiligten mit sich reißt, angefangen von der Spitze der Organisationen bis zum tiefsten hierarchischen Level. Eine Verunsicherung die zu Blockaden und Stillstand, zu übereilten, am falschen Ort getroffenen und aufgezwungenen Entscheidungen, Strukturen und Prozessen führt. Eine Verunsicherung, der es früh bewusst zu begegnen gilt, um nicht am Ende viel investiert und riskiert zu haben, ohne dabei auch viel zu gewinnen.
Die Entwicklung hin zu offeneren, schnelleren, anpassungsfähigeren Organisations- und Arbeitsstrukturen ist heute unter dem Stich-(oder Buzz-)wort „Agilität“ zur Massenware im Beratergeschäft mutiert. Da wird Agilität als neues Allheilmittel für die klassischen Altersleiden von in die Jahre gekommenen Unternehmen versprochen. Es werden die immer gleichen Strukturen ausgerollt – möglichst Strukturen, die auf bereits bekannten Ansätze beruhen. Ansätzen, die wiederum in kleinen, jungen Unternehmen Teil des Erfolgs waren und (halb)öffentlich in Videos und Büchern beschrieben sind. Gemixt mit „neuen“ Insights ergibt dies ein optimistisch klingendes Angebot, dass mit einfachen Mitteln vermarktet werden kann.
Neuer Lack auf alten Schläuchen
Diese „Lösungen“ werden über Organisation(seinheiten) ausgeschüttet, wie neuer Lack. Führungsrollen werden mit neuen hippen Titeln versehen, Chapters, Guildes und Triebes ersetzen Teams, Gruppen und Abteilungen (auch wenn sie in dieser Form alles andere als gleichwertig sind). Es wird umgebaut, neugestrickt, reorganisiert. Es wird, wie gehabt weiterhin am grünen Tisch zusammengewürfelt, wer welche Rollen übernimmt – schließlich gilt es Besitzstände zu waren. Kurz, es kommt alles, wie es immer kam…..
Okay, dass war die pessimistische Sicht auf die Dinge. Zu beobachten ist diese pessimistische Sicht aber leider zu oft auch bei vielen Mitarbeitern, die in Erwartung eines klassischen Changes in einer Mischung aus Peter Kruses „bend and wait“ und einer (leider nicht „ersten“) allgemeinen und manchmal tatsächlich totalen Verunsicherung reagieren. Doch damit wird dem eigentlichen Motor agiler Zusammenarbeit der Treibstoff entzogen, die freiwillige Beteiligung und das Engagement der Mitarbeiter.
Bitte versteht mich nicht falsch! Ich halte den organisationsindividuell optimierten Mix aus klassischen Managementmodellen und Adhocracy (dem Managementmodell zur Agilität), aus bewährtem altem und inspirierendem und Raum gebendem Neuen, für den eindeutig besten Weg, um optimale Zusammenarbeit zu gestalten und damit den Erfolg zu verbessern (wenn nicht, ihn zu optimieren)! ABER dies dann bitte auch aufmerksam mit offenen Augen und Ohren, in alle Richtungen blickend, alle einbeziehend, umfassend, systematisch und systemisch. Und wenn ihr dazu keine Zeit, Ruhe, Erfahrungen, Informationen oder Kapazitäten habt, dann lasst es, nehmt euch die Zeit und/oder findet die für euch passende Unterstützung.
SuperGAU und Flickenteppiche
Doch, soweit ich dies mitbekomme, ist es meist eben leider anders und wenn dann irgendwann auch die letzten Mitarbeiter aus der „bend and wait“ Versenkung wieder auftauchen, wenn es wieder darum geht miteinander an den Zielen, statt an der Struktur und den Prozessen zu arbeiten, dann bleibt oft nur der größte Feind gelebter Agilität: Unsicherheit.
Unsicherheit in Bezug auf die Passgenauigkeit der überstandenen und der weiter kommenden Organisationsentwicklung, der alten und neuen Führungsaufgaben und Rollenbeschreibungen und insbesondere Unsicherheit in Bezug auf die Auswirkungen agiler Organisations- und Arbeitsstrukturen auf die persönliche (Karriere)entwicklung. Am Ende bleibt von der groß angelegten, optimal durchgesteuerten, minutiös reporteten und gegenüber den KPI und Meilensteinen abgelieferten Transformation nur ein Haufen Scherben und der weitverbreitete Wunsch, doch bitte das alte Modell wieder aus dem Schrank zu holen. (Doch das wäre – gelinde gesagt – der SuperGAU. Denn die tatsächlich schon agile agierenden Kräfte würden gehen und der Organisation ihr heute so wichtiges, erdbebensicheres Fundament vollständig entziehen.)
Allerdings: der SuperGAU ist für die meisten wohl etwas ganz anderes, denn Un-Sicherheit ist weit weg von jeder planbaren Rationalität ein GEFÜHL. (So, jetzt ist es raus, das G-Wort…)
Wie Agilität auf einer Haltung fußt, sind zwei der wichtigsten, notwendigen Bausteine, um diese Haltung vermitteln die Wahrnehmung(!) von Stabilität und Sicherheit.
Noch etwas kommt hinzu. Neben der Haltung basiert vieles, was man zu einem agilen Verhaltensmuster zählen kann auf der Kombination von fachlicher UND sozialer Kompetenz. Gelebte Agilität ist im Grunde nicht anderes, als die Renaissance fachlicher und sozialer Fähigkeiten, jenseits von Planvorgaben, die auf einem grünen Flickenteppich im Elfenbeinturm entstanden sind.
Die „Anonymen Agilen“ sind keine Lösung
Bleibt die Frage, wie man dieser Unsicherheit begegnen, sie lindern und vielleicht sogar in das Gefühl von neuer Sicherheit überführen kann?! Wobei dies nicht nur eine Frage ist, sondern eine Frage pro betroffenem bzw. (und besser) Beteiligtem. Es ist eine Frage, die am Ende nur jeder für sich selbst beantworten kann, denn in der Antwort geht es darum, wie wichtig jedem selbst die persönliche Kontrolle, der individuelle Einfluss und die wahrgenommene Selbstwirksamkeit ist. Dabei unterscheiden sich die Antworteten auch in Bezug darauf, welche Rolle der Fragende in der Organisation hat. Handelt es sich um ein Mitglied des Top-Managements, um eine leitende (oder leidende) Führungskraft oder um einen „einfachen“ Mitarbeiter? Handelt es sich bei der Person um jemanden der Ambitionen in Bezug auf eine persönliche Weiterentwicklung und/oder (klassische) Karriere hat? Steht die Person am Anfang oder am Ende des Arbeitslebens? Wie sind die finanziellen, sozialen und gesellschaftlichen Verpflichtungen und, und, und… Das alles beeinflusst ganz natürlich die Antwort darauf, welches Maß an Sicherheit jemand braucht, um ein Thema bewusst mit(an)zugehen.
Wie einfach, wäre es da, wenn man einfach sich gegenseitig besuchende Gesprächskreise gründen würde: Die ‚AA‘ und die ‚AAA‘. Die ‚Anonymen Agilen‘ und die ‚Anonymen Anti-Agilen‘. Hätte man diese, könnte man beginnen in Diskussionen die Argumente auszutauschen und so versuchen sich bis auf die Gefühlsebene anzunähern.
Die Suche nach dem Antitoxin
Was also bleibt, um die Verunsicherung (wenigstens) zu minimieren und damit den Kollateralschaden in Grenzen zu halten?
„Was ist das Antitoxin, das es ermöglicht, tatsächlich gemeinsam das Thema Agilität im Unternehmen voranzutreiben? Es ist, so banal es wieder einmal klingt: Die frühzeitige und umfassende Beteiligung(smöglichkeit) aller.“ Allerdings keine basisdemokratische Beteiligung oder eine im Konsens oder Konsent. Es sollte eine Beteiligung auf Augenhöhe sein, bei der mit Erwachsenen auch erwachsen umgegangen wird. Mit allen Rechten und Pflichten, die die Zusammenarbeit an einem neuen Thema erfordert. Es ist eine Beteiligung, die auf der Basis von Deep Data (also einem tiefergehenden Verständnis für die Herausforderungen und die Status Quo der Organisation) in der Lage ist, allen klar zu vermitteln, dass die Intention von mehr Agilität ist, die Zusammenarbeit zu erleichtern, die Blockaden und Stolpersteine zu entfernen und die Leistungsfähigkeit der gesamten Organisation zum gegenseitigen Wohl zu erhöhen. Es ist eine Beteiligung, bei der auch ein gemeinsames Verständnis dafür entsteht, das Agilität nicht unmittelbar einer Karriere im Wege steht, jedenfalls dann nicht, wenn man aufgrund von Kompetenz mehr Anerkennung erhalten möchte, und das Agilität nicht bedeutet, dass der Job wegdigitalisiert wird, denn ‚Digital‘ braucht zwar ‚Agilität‘ als Basiskompetenz und nutzt digitale Werkzeuge, sie bedingt sie aber nicht.
Das alles zu vermitteln, zu erkennen, was, warum getan werden sollte, welche Probleme zu auf dem Weg zu lösen sind, wie eine gemeinsame UND starke Basis geschaffen werden kann, dabei im Management zu beginnen und Führung und Mitarbeiter einzubeziehen, ist das worum es beim Aufbau agiler(er) Strukturen geht. Es ist, was z.B. Agile Coaches mit den Teams und Agile Mentoren und Supervisor mit dem Management tun. Es geht um das gemeinsame Verstehen und Decodieren des Zustands der Organisation, bevor gestaltet und entwickelt werden kann. Es geht darum in die Organisation hinein- und mit ihr mitzugehen. Es geht darum, Raum für Beteiligung zu schaffen, für erlebbare Wirksamkeit, für hohe Beziehungsqualität, für Autonomie, für Austausch, Wertschätzung und Wertbeitrag. Es geht um die Klärung des Reiseziels und Offenheit für den gemeinsam zu gehenden Weg. Es geht um Lernen und gemeinsame Erfahrungen, um fachliche Fähigkeiten (ich wiederhole mich) und soziale Kompetenz. Das ist, was mich so an Agilität begeistert und, was wir bei AGILITYINSIGHTS als Agile Shift bezeichnen. Es ist die Grundlage des CoRE-Entwicklungsmodells und -Canvas und steckt tief in Transformationskonzepten wie der Corporate Co-Recreation. Und, natürlich steckt es auch in vergleichbar guten Konzepten vieler Kollegen).

Starting at the Top, starting to the top
Und doch – all das lässt sich weder von Berater- noch von Mitarbeiterseite starten. Es braucht immer das Bewusstsein der Mannschaft im Top-Management, die den ersten Schritt gehen müssen und deren Mut für diesen ersten Schritt nicht den Hochglanzbroschüren und vollmundigen Versprechungen der Kollegen aus „den großen Häusern“ zu folgen, sondern sich darauf einzulassen einen eigenen, nicht vordefinierten, aber dafür erfolgsversprechenderen Weg zu gehen. Zu oft musste ich schon als Außenstehender (und doch immer Mitfiebernder) mitansehen, dass der andere Weg, der oftmals stark vorgezeichnete Weg der „großen“, mindestens in die Irre, wenn nicht in den Abbruch der Transformation und zu leeren Budgetkassen geführt hat – bevor der Erfolg sich einstellen konnte. (Und nein – ich versuche mich hier nicht im Kollegenbashing.)
Daher lade ich euch alle und insbesondere die Entscheidet unter euch, (wieder einmal) ein, schaut euch um, findet Unterstützer und Unterstützerteams, die euch nichts versprechen außer Offenheit und Ehrlichkeit, die Analyse- und Entwicklungskompetenz, Engagement und gute Impulse mitbringen und die sich mit euch an einen Tisch setzen, um sich in die Details zu vertiefen und das große Bild immer wieder zu reflektieren. Findet Menschen, die zu euch passen und die auch bereit und in der Lage sind, Alternativen fern ab von Agilität mit euch anzugehen, wenn diese besser zu euch passen!
Doch seid auch gewarnt: Was auch immer euch versprochen wird: Der Weg ist selten ein leichter, er ist stetig und manchmal steil, es ist herausfordernd und zehrt an den Kräften. Aber ist man ihn erst einmal ein Stück weit gegangen, macht es Lust weitergehen. Er macht Lust die nächste Klippe zu meistern, sich hinter der nächsten Biegung überraschen zu lassen, er macht Lust zu einem (ersten Ziel) zu kommen, nur um dann festzustellen, dass nach einer kleinen Rast ein neues spannenden Ziel auf euch wartet.
Natürlich verunsichert die Idee von „Agilität“. Sie verunsichert so sehr, wie es verunsichert unvorbereitet das Matterhorn zu besteigen. Sie verunsichert, weil man im Bodennebel nicht mal die Hand vor den Augen sieht, weil man weder den Weg noch die Weggefährten oder die Ausrüstung kennt. Beginnt man aber langsam sich mit all dem vertraut zu machen, beginnt man auszuprobieren, wie man Haken setzt, wie man Sicherungsseile platziert, wie man Steigeisen anlegt, wer an welchen Stellen vorangehen und wer hinten sichern sollte, beginnt man zu lernen, wie das Wetter den Aufstieg beeinflusst, wann man gehen kann und wann nicht, wo die Biwakhütten sind und wie sehr man sich, trotz etwaiger Höhenangst, auf die Kameraden verlassen kann, dann steht der Aufstieg plötzlich unter einem guten Stern. Dann kann er gelingen und dann macht er anschließend vielleicht eben auch Lust auf die Besteigung weiterer Berge.
Meine Quitessenz
Ja, wenn sich Organisation(seinheit)en auf einen Entwicklungsweg begeben, wie es mit einem neuen Managementmodell – und nichts weniger steckt am Ende zwangsläufig hinter der Einführung von Agilität – der Fall ist, dann sollte damit auch immer Respekt vor der Aufgabe verbunden sein. Welchen Weg ihr auch immer geht, geht ihn bewusst und achtsam. Seid euch der Unsicherheiten bewusst und geht sie da ein, wo die Überwindung zu einem Erkenntnisgewinn führt. Und: Lasst euch nicht verunsichern, sondern sucht euch lieber die für euch passenden Weggefährten. Denn der Weg hin zum richtigen Mix aus Agilität und anderen Ansätzen lohnt in jedem Fall.