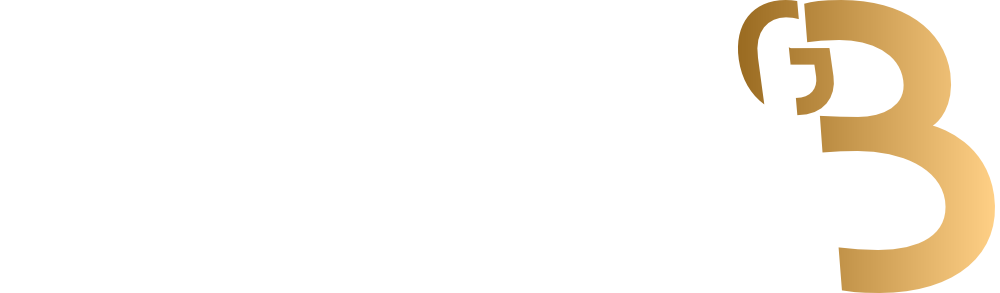02.07.20 | Blog, Leadership / Führung, Management, Nachhaltigkeit, Organisationale Agilität, Wirksamkeit, Zusammenarbeit |
>>>> Reflexionsimpuls
Manchmal stelle ich mir die Frage, wie Unternehmen aussehen und funktionierten würden, wenn KI („Künstliche Intelligenz„ besser „automatisierte Datenanalyse“) Management- und Führungsrollen einnehmen würden. (Zur Einordnung der Begriffe: „Management“ = Festlegen der Regeln, Strukturen und Prozesse, „Führung“ = Interaktion mit den Mitarbeitern, um die vom Management vorgegebenen Regeln, Strukturen und Prozesse so zielgerichtet zu leben, dass die Vision des Unternehmens Wirklichkeit wird.)
Erste Experimente zu KI in der Führung gab es vor einigen Jahren. Damals wurden die von KI Entscheidungen im Durchschnitt positiver bewertet als die menschlichen Führungskräfte. Heute arbeiten Startups an Möglichkeiten Führung durch KI zu verbessern. Doch, was verbessert sich dann? Werden wir mit Hilfe von KI rationalere Entscheidungen treffen können. Werden wir zukünftig rein logisch vorgehen? Nach ethischen und moralischen Grundsätzen werden wir dann handeln? Wird es gelingen Empathie und soziale Aspekte einzubinden und wie wird das geschehen? Welche Annahmen und Zielsetzungen werden dem zugrunde liegen? Wie wird Führung dann sein und wahrgenommen?
Bis dahin werden Menschen und Menschlichkeit weiterhin wichtiger und integraler Bestandteil von Management und Führung bleiben. Ob dies zu unserem Vor- oder Nachteil ist, hängt allein von den (organisations)individuellen Gegebenheiten ab. Nach welchen Regeln gearbeitet wird, welchen Menschenbild vorherrscht, nach welche Zielen und Vorgaben gearbeitet und welches Kulturbild im Unternehmen gelebt wird, definiert, wie menschlich dort gehandelt wird. Noch wird all dies durch die Menschen im Unternehmen, mit mehr oder weniger direktem Einfluss, selbst festgelegt. Dabei haben diejenigen an der Spitze meist deutlich mehr Einflussmöglichkeiten, als die weiter „unten“. Die Frage ist, mit welchem Bewusstsein, dies geschieht und wie sehr sich dies an den persönlichen Bedürfnissen, Zielen und Wünschen von Top-Entscheidern und Führungskräften ausrichtet. Und schließlich ergibt sich daraus die Frage, wie sehr das Geschick und der Erfolg von Unternehmen von den Bedürfnissen und den Wahrnehmungen einzelner abhängen muss und sollte?
System(isch)-bedingte Herausforderungen
Schon auf der individuellen Ebene, im eigenen Lebenssystem, sind wir ständig mit unseren Bedürfnissen, Gefühlen und unserer Ratio konfrontiert – und, zumindest gilt dies für mich – auch immer mal wieder überfordert. In kleinen und größeren Gruppen potenziert sich dieses systemische Element, weshalb es gerade für die (Top-)Führungsebenen, an denen viele dieser systemische Stränge zusammenlaufen, ohnehin enorm schwierig ist, mit bestem Wissen und Gewissen und zum Wohle des Unternehmens gut und bewusst zu führen. Die aktuellen Gegebenheiten erhöhen hier oftmals den Druck dramatisch und machen es nahezu unmöglich die ‚richtigen’ Entscheidungen zur ‚richtigen’ Zeit zu treffen.
Wem es gelingt in einer Organisation auf der Karriereleiter aufzusteigen, der hat gemeinhin vor allem fachlich überdurchschnittliche Leistung gezeigt. Mit diesem Aufstieg steigt die positive Selbstwahrnehmung und ein gewisser Stolz auf das Erreichte, gerade auch, weil es von der Umwelt meist als als außergewöhnlich wahrgenommen wird. Man muss schon häufig richtig entschieden und das richtige getan haben, um berufen zu werden, den nächsten Schritt zu gehen. Je höher die erreichte Position, desto mehr wächst das Bewusstsein, für die eigene, herausragende Rolle. Für viele ist es eine Ehre eine hierarchisch bedeutende(re) Positionen auszuüben und, in den klassischen Strukturen, damit auch immer wichtigere Entscheidungen treffen zu können. Persönlicher Ehrgeiz ist oftmals die treibende Kraft für das aufzubringende Engagement und die auf diesem Weg internalisierten Handlungs- und Haltungsmuster verstärken und verfestigen sich naturgemäß.
Mitternacht Nr. 2
Prof Eddie Obeng, von der, in britischen Reading beheimaten Henley Business School, hat den Zeitpunkt an dem das Internet allen zur Wissensgewinnung und Interaktion zur Verfügung stand, als ‚Mitternacht‘ definiert, als Zeitpunkt des großen Wandels, als Beginn einer neuen Ära. Ich sehe mit schnellen Schritten das nächste ‚Mitternacht‘ auf uns zukommen. Mitternacht Nr. 2 ist der Moment, an dem wir realisieren, das die alten Handlungs- und Verhaltensmuster, die über Jahrhunderte Führung und Management in Unternehmen geprägt haben, nicht mehr funktionieren und wir beginnen (müssen und können) neue Muster zu etablieren.
Wie nah dieses zweite Mitternacht ist, erkennen wir daran, dass bis vor einigen Jahren in (fast) allen Branchen und (fast) allen Unternehmen die alten Muster noch gleichermaßen gut funktionieren. Inzwischen jedoch, zusätzlich angefeuert durch die Coronakrise, wird immer klarer, dass das alte ‚Richtig‘, d.h. die bisherigen Strukturen, Prozesse und vor allem Entscheidungsprinzipien, -wege und -regeln nicht mehr zu den gewünschten Resultaten führen. Sie passen schlichtweg immer weniger zu den neuen Herausforderungen. Entsprechend wird mit „neuen“ Konzepten wie Agilität, neuen Organisationsformen, Innovationsmodellen und kreativen Problemlösungsmethoden versucht, diese Symptome des fundamentalen Wandels der sozialen, ökonomischen und ökologischen (Arbeits-)Umgebungen, zu heilen.
Die Sehnsucht nach einem neuen, zeitgemäßeren ‚richtig‘ ist groß. Es ist klar, dass ein gesamtes neues Set an Verhaltens-, Haltungs- und damit Vorbildmuster, gerade auf der Führungsebene, notwendig ist, um mit den Folgen dieser Entwicklungen im eigenen Unternehmen umgehen zu können. Die aktuellen Herausforderungen lassen kaum mehr zu sie entsprechend der alten Muster überhaupt zu bearbeiten, geschweige denn, sie erfolgreich lösen. Für viele bedeutet dies einen, schmerzhaften, weil an tiefen, lange aufgebauten und verankerten Überzeugungen rüttelnden Wandel eigener Überzeugungen und des Selbst-Verständnisses von Management und Führung.
Doch, auch wenn der kommende Wandel so sehr schmerzt, weil er vor allem die Führungsebenen der Unternehmen im Fokus hat, ist es wichtig und dringend ihm jetzt ins Auge zu blicken. Er verlangt die Entwicklung neu zu etablierender Führungs- und Managementkompetenzen, deren Verlauf sich einer klassischen Wellenkurve beschreiben lässt.

Einschub: Die Schritte auf der Management Change Kurve
- Überschätzung des persönlichen Einflusses – Man stellt fest, dass die Dinge doch nicht immer so laufen, wie geplant. Die Mitarbeiter entscheiden kurzfristiges selbst, einfach, weil sie es müssen. Die Ziele werden nicht erreicht, nur weil wahlweise ein Virus, neue Dynamiken, die Globailisierung, die Digitalisierung oder ungeahnte Komplexitäten die Welt im Griff halten. Kunden informieren sich im Internet selbst und kaufen dann auch noch woanders.
- Zweifel / Schock – Man fühlt sich ausgeliefert und aller Handlungsmöglichkeiten beraubt. Die einst so positive wahrgenommene (mit weitgehendere) Unabhängigkeit ist plötzlich Geschichte. Man weiß nicht so recht, wie die Dinge weitergehen sollen.
- Ablehnung / Leugnung – Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Umstände werden negiert, die eigene Kompetenz besonders herausgestellt, schließlich ist einem so etwas noch nie passiert. Man geht davon aus, dass sich die Welt schnell wieder zurückdrehen wird. Es wird klar und deutlich entschieden, egal wie.
- Widerstand / Zorn / Neid – Die Wahrnehmung wächst, dass es andere nicht so sehr trifft – auch wenn dies nur oberflächlich so scheint. Das eigene Schicksal wird verflucht, der Neid wächst und damit der innere Widerstand gegen die Veränderung.
- Depression – Alle Stricke reißen. Das unvermeidliche wird (endlich) auch als unvermeidlich wahrgenommen und als, vor allem, persönliche Niederlage wahrgenommen. Das Leben und die Welt scheinen sich endgültig und unabwendbar verschworen zu haben.
- Akzeptanz – Mit der Akzeptanz der Gegebenheiten wird der erste Schritt gegangen, um mit den äußeren Veränderungen umzugehen. Die Dinge sind wie sie sind und es kann nach Wegen gesucht werden, aus den veränderten Umständen (persönlich) positive Entwicklungen abzuleiten.
- Erkenntnis – Es wird klar, dass alte Verhaltens-, Haltungs-, Wertemuster in der bisherigen Form nicht mehr anwendbar sind. Die systemisch komplexen Zusammenhänge werden klarer und damit auch die Notwendigkeit die vorhandenen Ressourcen neu zu strukturieren und ggf. anders zu nutzen.
- Gemeinsames experimentieren & lernen – Als Folge eines neuen Systemverständnisses wird mehr gemeinsam und mit offenem Ausgang diskutiert und gedacht. Gemeinsames experimentieren und lernen wird als sinnvolle Alternative zum vorherigen Vorgehen anerkannt.
- Verbesserung von Selbstvertrauen & Resilienz – Mit dem Verständnis, dass man in der Gemeinschaft den Herausforderungen gelassener entgegenblicken und sie meistern kann, wächst auch das Selbstvertrauen in die gemeinsamen und – durch den gleichzeitigen Lerneffekt – auch in die persönlichen Fähigkeiten.
- Aufbau neuer Führungskompetenz – Auf der Basis eines grundlegenden Führungsverständnisses entsteht durch eine neue, positivere Wahrnehmung der gemeinsamen Leistungsfähigkeit neue Führungskompetenz, die langfristig erfolgversprechend ausgebaut werden kann.
Teil dieses Wandels ist es, das Unternehmen für mehr partizipatives und partnerschaftliches Miteinander und für mehr gelebte Menschlichkeit zu öffnen, denn diese ist (und bleibt) die ‚Secret Sauce‘, die geheime Zutat, die es erlaubt auf die vollen Potenziale und Fähigkeiten aller Mitwirkenden zuzugreifen. Das dies nicht zur Selbstaufgabe von Führung und Management führt, ist mittlerweile common sense. Im Gegenteil, je mehr es darum geht bewusst neue und besser wirkende Regeln, Routinen und organisationale Systeme zu etablieren, die diese neue Art der Zusammenarbeit optimal unterstützen, desto mehr sind hochklassige, zeitgemäß agierende Manager und Führungskräfte notwendig und gefragt.
Was tun?
1) Zunächst hilft nur, den Balken aus dem eigenen Auge zu entfernen.
2) Die Situation mit ausreichendem Abstand analysieren:
- Szenarien durchspielen, in denen der eigene Einfluss nicht mehr so groß ist wie gedacht.
- Antworten auf die Frage finden, wie es dem Unternehmen ergeht, wenn man 3 Monate ausfällt – in einem Umfeld wie es vor der aktuellen Krise, während der aktuellen Krise und nach der Krise existiert. An welchen Stellen läuft es dennoch gut, an welchen Stellen entstehen Probleme und welche und wie könnte man diesen Problemen begegnen?
- Sich Sparringspartner suchen, mit denen die Situation im kleinen, vertrauenswürdigen Kreis, diskutiert werden kann.
3) Eine Standortbestimmung für die Gruppe, den Bereich und/oder das Unternehmen durchführen:
- Welchen Einfluss haben die Mitwirkenden selbst auf die Entwicklung?
- Welche Szenarien sind möglich, welche wahrscheinlich, welche realistischen Optionen gibt es?
- An welchen Stellen kann die Organisation anders agieren und was ist dazu notwendig?
4) Externe Impulse einbringen, um den Blick zu weiten und neue Horizonte zu eröffnen:
- Zuhören, die Impulse wirken lassen und auch unbequeme Wahrheiten zulassen.
- Die Impulse und die eigenen Überlegungen aus den ersten Phasen zusammenbringen und alles zusammen neu bewerten. (Wobei gilt, dass die externen Impulse selten 1zu1 zu den tatsächlichen Optionen der Organisation passen. Hier ist immer gemeinsames Denken und Zusammenarbeit gefordert. Wir nennen dies diagnostisches Mentoring.)
5) Die Erkenntnisse einige Zeit sacken lassen, nichts übereilen, und erst Denken und Emotionen miteinander in Einklang bringen.
6) Mehr Zusammenarbeit zulassen:
- Die Quintessenz aus den Analysen und Diskussionen erzeugen und das organisationale Betriebssystem im Detail betrachten und die Punkte identifizieren, die verändert oder neu etabliert werden sollten.
- Den Fokus vom Individuum auf die Emergenz der Zusammenarbeit lenken.
7) Mit und nach all diesen Maßnahmen wird sich das Gesamtgefüge der Organisation verändern. Das Selbstvertrauen und die Resilienz steigen bei allen Beteiligten. Führung und Management werden sich verändern und damit die Rolleninhaber neue Kompetenzen entwickeln.
Diese Schritte zu gegen verlangt nach dem Verständnis für ein „Next Management“, einer Weiterentwicklung, die sich oftmals anhand von fünf Fokusbereichen beschreiben und ableiten lässt: Next Culture, Next Power & Performance, Next People Relations, Next Leadership und Next Organizing System. Was dahinter steckt, erläutere ich gerne in einem persönlichen Gespräch, und, in den Grundzügen, in meinem nächsten Blogpost.
17.06.20 | Blog, Leadership / Führung, Management, Organisationsgestaltung, Zusammenarbeit |
Wir sind Export- und Mittelstandsweltmeister. Die Anzahl der Hidden Champions ist fast unüberschaubar. Es geht uns gut, und deutlich besser als anderen Ländern, die von Corona UND der Wirtschaftskrise gebeutelt werden, auch wenn, ja, die Krise auch bei uns enorme wirtschaftlich Folgen hat und haben wird. Wie Gunter Dueck so richtig in seinem aktuellen Beitrag schreibt wird in dabei wichtig sein nach dem hinfallen anders wieder aufzustehen.
Basis unserer Position als führende Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten ist dabei nicht durchschnittlich gut zu arbeiten und viel Glück zu haben, sondern es sind Spitzenleistungen, die uns das, was wir – viele einzelne, aber auch als Gesellschaft – Wohlstand nennen, ermöglichen.
Doch dieser Wohlstand, diese Spitzenleistung wird allzu oft teuer erkauft. Viele erbringen individuelle Spitzenleistung bis zum Erbrechen und zu oft bis zum Burn-Out. Sich für das Unternehmen zu verausgaben, sich Tag und Nacht einzubringen erscheint notwendig und gesellschaftlich etabliert und goutiert, um die individuelle Sicherheit durch Sichtbarkeit und Engagement zu erlangen. Es scheint, als seinen nur durch diese, manchmal übermenschlich anmutenden Beiträge, die großen Erfolge unserer Wirtschaft möglich. Es scheint, dass wir alle wenigen Leistungsträgern zu Dank verpflichtet sind, weil sie es sind, auf die wir alle bauen.
Doch, was ist dran an dieser Wahrnehmung? Ist die Spitzenleistung von Organisationen darauf angewiesen, dass einzelne sich bis zum Umfallen verausgaben? Ist die gemeinsame Spitzenleistung von Teams und ganzen Unternehmen in Gefahr, wenn die Top-Performer ausfallen?
„Höchstleistung ist zwar kontinuierlich möglich, aber nicht ständig.“
Klar, Unternehmen brauchen kontinuierliche Bestleistungen, um in eine Spitzenposition zu gelangen und um sich dort zu behaupten. Wer dauerhaft Mittelmaß liefert, dem ist dieses Status verwehrt. Sie brauchen, um mit Prof. Heike Bruch zu sprechen, sowohl ein hohes Maß an produktiver Energie, als auch Raum für angenehme Energie, um anschließend mit neuer Kraft weiterzumachen.
Ebenso wichtig, um kontinuierlich Höchstleistung zu erbringen und ebenso weit weg von einem „nur“ durchschnittlich hohen Leistungsniveau ist gerade heute, dass die Organisation in der Lage sein muss, mit den aktuellen (und den kommenden) „Störungen“ von außen konstruktiv umzugehen, sich flexibel und schnell anzupassen und sie ohne wesentliche Beschädigung zu meistern. Diese Störungen sind immer vielfältiger. Am augenscheinlichsten sind sie in Form neuer Anforderungen in Kontext Digitalisierung, der Arbeit in einem zunehmend dynamisch komplexen Umfeldern oder (auch) in globalen Krisen, wie Corona.
Dies, idealerweise, während im Innern der Organisation keine weiteren„Störungen“ entstehen, bzw. diese, und alle strukturellen und prozessualen Hemmnisse ohnehin auf ein Mindestmaß reduziert sind.
Aber, wieviel Höchstleitung brauchen wir, wer soll sie vollbringen und wie?
Welches Ideal steckt dahinter? Individuell und organisational?
Einige Kommentare auf Linkedin nach meinem letzten Blogbeitrag haben mich dazu gebracht, das Thema nochmal tiefer zu durchleuchten, weil ich wahrnehme, dass wir ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dem Begriff „(Spitzen)Leistung“ verinnerlicht haben.
Auf den ersten Blick erscheinen zwei Ideen wesentliche Teile der Welt der Höchstleistung zu erklären. Es geht einerseits scheinbar um den ökonomischen Profit der Organisation und auf der anderen Seite um individuellen Gewinn, wobei auf dieser Ebene oft auch intellektuelle oder soziale Beweggründe dahinter stecken, etwa in Form von neuen Erfahrungen oder von sozial-hierarchischem Aufstieg und Status.
Zugleich scheint es, als würde der Begriff Höchst- und Spitzenleistung, gerade im New Work und ‚Human Resources‘ Kontext, immer kritischer gesehen. Die Begriffe, so scheint es, sind inzwischen Synonyme für schlechte Führung und nicht mehr zeitgemäße Rahmenbedingungen, beziehungsweise individuelle Selbstaufgabe und damit mangelnde Selbstverantwortung. Wobei zugleich Selbstverantwortung ein zentrales Ziel und Element von New Work ist.
Mein AGILITYINSIGHTS Kollege Lukas Michel kommentierte dies in einer mail an mich wie folgt: „Höchstleistung ist das, was Menschen, welche selbstverantwortlich handeln aus eigenem Trieb und Wunsch heraus, ganz natürlich tun – wenn sie dabei nicht von sich selbst oder von anderen (Organisation) gestört werden. Höchstleistung ermöglicht Flow, was alle wollen. Menschen wollen lernen und besser werden. Das ist nichts Negatives, sondern ganz im Gegenteil etwas Wünschenswertes. Was wäre unsere Welt, wenn nur noch Durchschnitt geliefert wird?“
Er schreibt weiter: „Wenn Führungskräfte „Drill“ betreiben, dann hat das einen negativen Einfluss auf die Leistung und kann die oben erwähnten Effekte auslösen. Drill hat nur in extremen Situationen (Militärkampf / Krise / usw.) einen kurzfristig positiven Effekt auf Leistung. Das sind aber die Ausnahmen, nicht die Regeln. Drilleffekte haben aber nichts mit Höchstleistung zu tun, sondern mit schlechter Führung oder Führung in Ausnahmesituationen. Ursache und Wirkung werden da bewusst vertauscht.“
Unser Bedürfnis nach Hochleistung
Hinter Höchstleistung auf individueller Ebene stecken oft teils existenzielle Bedürfnisse: (Selbst)Wirksamkeit zu erleben, Verbundenheit zu erfahren, Sicherheit zu besitzen, Lernen und sich entwickeln zu können, Wachstum sicherzustellen, Sichtbarkeit zu bekommen, Wertschätzung zu genießen, Unterstützung zu geben. Gehen diese mit positiven Gefühlen einher, sind sie also nicht getriggert aus z.B. Angst, Scham, Einsamkeit oder Ohnmacht, und gesellen sich Elemente wie etwa zeitnahes Feedback und Autonomie sowie ein sinnvolles Maß an Herausforderungen hinzu, so verbindet sich Arbeit mit Flow und Flow mit gerne beigesteuerter Höchstleistung [sic].
Auf der organisationalen Ebene gilt, dass ein Team aus individuellen Top-Performern gut und nett sein kann (wenn sie den überhaupt funktioniert), das aber (fast) jedes Team, dass den Raum und die Freiheit besitzt emergente Hochleistungszusammenarbeit für sich zu gestalten, mehr Leistung erzielt. Die Basis dafür muss allerdings tief in der Kultur und den strukturellen und prozessualen Rahmenbedingungen, dem organisationalen Betriebssystem verankert sein, was häufig genug nicht der Fall und nicht-trivial zu implementieren ist. Es sind die Dinge, die ich gefühlt schon 1000-mal hier beschrieben habe: Vertrauen in sich und das Team, gegenseitiges Verständnis, starke Verbundenheit, Dynamische Fähigkeiten (Flexibilität, Anpassungsfähigkeit), eine gemeinsame Wertbasis, ein Wir-Gefühl, ein gemeinsames ‚Warum‘ und ‚Wozu‘, Raum für Selbstverantwortung und Wahlfreiheit, gute Beziehungen und Fokus. Ist ein solches soziales Umfeld in einer Organisation gegeben, fällt es leicht(er), sich immer wieder selbst mit Spitzenleistungen in Bezug auf Wissen, Ideen und Erfahrungen ins Team einzubringen. Doch, wie es bei organisationalen Themen immer ist, dies ist eine, wenn nicht die wichtigste Management- und Führungsaufgabe, die zugleich fast immer hinter dem Alltagsgeschäft und strategischen Planungen zurücksteht.
Timothy Gallwey, der Business Coach, Berater und Autor der „Inner Game“ Bücher, beschreibt den Weg zu mehr gemeinsamer Höchstleistung so: „Freude, Lernen und Leistung gehören zu dem, was selbstverantwortliche Menschen sich in ihre Zielvereinbarung schreiben sollten.“
Wenn das gelingt, ist Höchstleistung in Teams und Organisationen möglich ohne, dass Menschen dabei Gefahr laufen sich zu schädigen und im Burn-out zu landen. Wenn es gelingt diese Wahrnehmung in Verhalten und Haltung zu überführen, können wir auch wieder freier von Spitzenleistung sprechen, ohne das Gefühl zu haben, das darunter jemand leiden musste.
Epilog
Es gibt die unterschiedlichsten Definitionen zum Thema Höchstleistung und insbesondere High-Performance Teams. Eine der einfachsten und klarsten habe ich bei Prof. Wolfgang Jenewein von der Hochschule St. Gallen gehört: Es braucht eine klare Vision (ein Warum und Wozu), Wir-Gefühl (Verbundenheit) und eine gemeinsame Wertebasis.
Andererseits ist diese Definition nur schwer in Organisationen identifizier- und verifizierbar. Das Konzept, dass es mir am leichtesten ermöglicht die Grundlagen für Höchstleistung in Organisationen zu analysieren, ist das Performance Dreieck von Lukas Michel und die darauf aufbauende Diagnostik. Inzwischen gibt es diese auch in einer Version, die die Rahmenbedingungen auf individueller Ebene betrachtet (‚MEIN FLOW SCAN‘). Wer hier tiefer einsteigen will, kann sich gerne bei AGILITYINSIGHTS informieren, oder direkt auf mich zukommen.

04.06.20 | Blog, Leadership / Führung, Management, Zusammenarbeit |
>>>> Reflexionsimpuls & Konkrete Tipps
So wichtig und verlockend es ist, sich in der jetzigen Zeit immer wieder mit den direkten Folgen der Pandemie zu befassen, so wenig hilft uns dies mit Blick auf mittelfristige Entwicklungen. Natürlich ist es wichtig jetzt zu handeln, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu erhalten, dennoch ist es der falsche Weg dabei Zustände beizubehalten oder gar zu manifestieren, die nach dem Ende der Einschränkungen, diese Unternehmen unverändert zum vorherigen Status Quo gleich wieder in die nächste Krise stürzen. Selten war ein Zeitpunkt geeigneter als jetzt, um grundlegende Veränderungen anzugehen.
Ein klassischer Indikator für den Zustand eines Unternehmens ist dessen, tief in die Kultur, die Führung und das gesamte Managementsystem implementierte, Definition von „Arbeitsleistung“. Sie wird in den allermeisten Fällen in einer, zwar klar formulierten aber dennoch wenig stringenten Mischung aus der zeit- und zielbasierten Erfüllung von Vorgaben gemessen. Leistung ist, klassisch definiert, ‚individuelles Arbeitsvolumen pro Zeit‘ – meist zudem festgemacht an einer fest vereinbarten „Anwesenheitszeit“.
Auf Basis dieses Verständnisses werden jährlich Boni verteilt, Entwicklungswege festgelegt und Beförderungen ausgesprochen. Menschen werden danach bewertet, abgestraft und belohnt. Wer sichtbar ist und beobachtbar „busy“ wirkt, auch wenn dies manchmal nur mehr fake als Fakt ist, wird als fleißig und Leistungsbereit wahrgenommen. Wer seinen Aufgaben an anderen Orten nachkommt, wer „irgendwo in der Weltgeschichte rumgondelt“ und fertige Arbeitspakete ohne viel Brimborium abliefert, ist, in der allgemeinen Wahrnehmung, deutlich seltener Leistungsträger.
Schon seit Jahren ist in 95% aller Branchen und Arbeitsbereiche der Solo-Akteur den Teams weit unterlegen. Zu schnell haben sich Wissen und Informationsmöglichkeiten verändert. Die aktuelle Situation hat viele Unternehmen in eine Zwangsbeschleunigung ihrer Digitalisierung gezwungen. In der Folge werden wir uns von der Wahrnehmung (vor allem) ‚individueller Leistungsfähigkeiten‘, nach dem erfolgten Kennenlernen digitaler Collaborationsmöglichkeiten, stärker zu ‚gemeinsamen Leistungsfähigkeiten‘ orientieren.
Gemeinsame statt individueller Leistung ist immer mehr der Garant für organisationales und unternehmerisches Überleben. Sie braucht dafür notwendigerweise Bausteine im Fundament des Unternehmens, die sich von denen für individuelle Leistung unterscheiden. Natürlich baut auch gemeinsame Leistung immer auch auf individuellem Leistungsvermögen und Leistungsbereitschaft auf, doch ohne die anderen, ohne den Austausch, ohne gemeinsames Lernen und ohne einen Raum der erlaubt wieder aufzutanken, die investierte Energie zu regenerieren, wird kaum ein Unternehmen die bevorstehende Zeit überstehen.
Zeit also, sich mit dem Thema Team(hoch)Leistung intensiver auseinanderzusetzen.
Gemeinsame Leistungsfähigkeit im Team ist in viel größerem Umfang von der Kultur, der Führung und die, durch das Management gesetzten, Basis- und Rahmenparameter abhängig, als individuelle Leistung. Wer Leistung von Teams erwartet, vielleicht sogar Hoch- oder Höchstleitung, der kommt nicht umhin, sich bewusst und ausführlich mit den (Un)Tiefen der genannten Bereiche auseinanderzusetzen.
Leistung = Potenziale – Hemmnisse
Eine alternative Definition von Leistung lautet: Leistung ist möglich durch die Nutzung der Potenziale, Erfahrungen und Fähigkeiten unter Vermeidung und Elimination möglicher Hemmnisse und Störungen. Dies gilt für individuelle Leistung, viel mehr jedoch für gemeinsame, da hier durch Emergenz die Potenziale wachsen und Störungen leichter vermeidbar sind.
Die Erfahrung zeigt, dass es sich besonders lohnt drei Kategorien und darin jeweils vier Themenbereiche immer wieder zu (selbst)kritisch zu betrachten.

In der Kategorie „organisational“ sind dies: Sinn & Vision, Resilienz, Beziehungen und Strukturen.
In der Kategorie „sozial“ sind es: Zuversicht, Lernen, Zugehörigkeit und Sicherheit.
In der Kategorie „individuell“ sind es: Fokus, Autonomie, Austausch und Vertrauen.
Ein klares Bewusstsein für die Relevanz aller Themenbereiche und die konsequente Führungs- und Managementarbeit hilft und ist notwendig, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Arbeit echte Teamarbeit zu (Hoch)Leistung führt. Eine regelmäßige Reflexion schafft die Grundlage, um an diesen Stellen mehr Klarheit zu gewinnen und eine höhere Aufmerksamkeit zu etablieren.
Reflexionsfragen und Impulse
Aus der Erfahrung habe ich folgende Fragestellungen zur individuellen und gemeinsamen Arbeit entwickelt, die ihr gerne für euch nutzen könnt:
Zu den Themen im Kontext „organisational“:
- Sinn & Vision: Ist der Sinn der gemeinsamen Arbeit allen so klar und bewusst, dass wir alle unser Handeln, als Individuum und als Team, daran ausrichten (können)?
- Resilienz: Vermittelt der Aufbau und der zwischenmenschliche Umgang die Wahrnehmung, dass wir in der Organisation ausreichend Selbststeuerungskompetenzen und Widerstandsfähigkeit besitzen, um uns (relativ) unabhängig von äußerem Geschehen auf eine optimale Zusammenarbeit konzentrieren können?
- Beziehungen: Bieten wir ausreichend Plattformen und Gelegenheiten, um unsere Beziehungen, das gegenseitige Verständnis und Wissen übereinander zu vertiefen?
- Strukturen: Sind unsere Strukturen (, Routinen und Prozesse) dazu geeignet, Zusammenarbeit in Teams und über Teamgrenzen hinweg zu unterstützen und leicht und einfach zu machen?
Zu den Themen im Kontext „sozial“:
- Zuversicht: Vermitteln wir ein starkes, glaubwürdiges Bild von der Zukunft?
- Lernen: Geben wir uns (individuell und in den Gruppen) ausreichend Gelegenheit, uns mit neuen Themen auseinanderzusetzen und Dinge auszuprobieren?
- Zugehörigkeit: Sehen wir uns als starke Gemeinschaft, die wir gerne weiter voranbringen möchten und in der wir uns gegenseitig besonderen Schutz geben?
- Sicherheit: Wie stark ist das Gefühl psychologischer Sicherheit bei jedem einzelnen und wie stark arbeiten wir daran, dieses jedem einzelnen zu vermitteln?
Zu den Themen im Kontext „individuell“:
- Fokus: Hat jeder von uns ausreichend Gelegenheit fokussiert an seinen Themen zu arbeiten, d.h. hat er die Zeit und den Raum dafür?
- Autonomie: Kann jeder, im Rahmen seiner Rollen und Aufgabenbereiche, frei entscheiden, wann und wie Dinge angegangen und erledigt werden?
- Austausch: Hat jeder ausreichend Gelegenheit sich zu den Themen die beruflich oder privat Dialog und Diskussion erfordern, auszutauschen?
- Vertrauen: Wie signalisieren wir jedem einzelnen das Maß an Vertrauen, dass wir in die Person und in die Arbeit dieser Person haben?
Bei all diesen Fragen ist der Austausch mit den Mitarbeitern und Kollegen enorm wichtig. Unsere eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit den Reflexionstools aus dem AGILITYINSIGHTS Angebot, wie auch eine Vielzahl von Studien zeigen, dass die Menschen an der Spitze von Organistion(sbereich)en, die Situation innerhalb ihres Bereichs um 15% – 20% besser einschätzen, als die Mitarbeiter selbst, der Confirmation Bias in Reinkultur. Ein Unterschied, der sich natürlich signifikant auswirken kann.
Impulse
Wie kann man an den Themen arbeiten? Was kann man tun, wenn man sich nicht sicher ist, welcher Weg geeignet erscheint, oder die Lage sich nur schwer evaluieren lässt, zum Beispiel weil der Confirmation Bias es nicht (oder kaum) zulässt die Situation objektiv einzuschätzen?
Wie bei allen umfassenden Entwicklungsthemen, die immer ja auch den Status Quo und damit die Kultur beeinflussen, sind (mentaler) Abstand und Objektivität wichtig. Diese gelingt manchen aus dem laufenden Betrieb heraus, vielen Unternehmen hilft es, diese in unabhängigeren Institutionen oder Menschen zu finden. Manchmal sind die Querdenker in den eigenen Reihen kompetente Partner bei dieser Arbeit, manchmal hilft nur der Ruf und Blick nach außen. Dazu gibt es eine Vielzahl geeigneter Analysewerkzeuge für die vielen ggf. betroffenen Teilbereiche. Als Startpunkt habe ich eine kleine Checkliste erstellt, der Anhaltspunkte gebe kann, an welchen Stellen besondere Aufmerksamkeit notwendig ist. Mehr dazu am Ende des Beitrags.
Und, natürlich gibt es eine Menge guter Impulse, die den Menschen, den Teams und schließlich auch der Organisation helfen können. 20 erste Stichpunkte dazu gebe ich euch hier mit auf den Weg. Insbesondere für Führungskräfte lohnt es, sich mit diesem Punkten intensiver zu befassen:
- Aktives Zuhören
- Bewusste und gezielte Kommunikation
- Bidirektionales Mentoring (Langfristige gegenseitige Unterstützung)
- Mentoring Moments (Raum für 1h Stunde Mentoring mit geeigneten Kandidaten)
- Bewusst persönliche Verletzlichkeit aufzeigen
- Expliziter Dank
- Gemeinsame Kaffeepausen (auch online!)
- Feedforward statt Feedback (d.h. richtet den Blick in die Zukunft)
- Entspanntheit und Spaß zulassen
- Fragen stellen, wie: ‚Was sollte ich öfter tun, was weniger, was nicht mehr? Wie kann ich deine/eure Effektivität unterstützen?’
- Offenes und aufrichtiges Feedback
- Walk the talk
- Prioritäten sehr explizit aufzeigen und verstehen
- Routinen und Rituale nutzen
- Slogans aktiv einsetzen (‚Haribo macht Kinder froh…..‘ – findet den Slogan der euer Ziel kurz und prägnant beschreibt)
- Arbeitsraum bewusst betrachten und die Augen anderer dafür öffnen (wie und wo findet Arbeit WIRKLICH statt)
- Gemeinsame Verantwortlichkeiten
- Mögliche Erfolge aufzeigen
- Gemeinsamen Stolz und Perspektive aufbauen
Ansätze
Neben den genannten Impulsen gibt es aus dem weiteren Kontext zeitgemäßer Zusammenarbeit, auch z.B. im Bereich von New Work, eine Vielzahl interessanten und leicht umsetzbarer Ansätze und work-hacks. Welche davon für euch genau passen, sprengt naturgemäß hier den Rahmen.
Um die Auswahl geeigneter Vorgehensweisen etwas zu erleichtern, habe ich, wie oben schon erwähnt, eine Checkliste mit weiteren Reflexionsfragen sowie einer Anleitung zur Auswertung erstellt, die du hier gegen eine geringe Schutzgebühr herunterladen und immer wieder nutzen kannst. Diese erste Reflexion erlaubt es, unabhängig von deiner Position und Rolle im Unternehmen für zu klären, an welchen Stellen mit Blick auf eine verbesserte Zusammenarbeit Initiativen gestartet werden sollten.
Weitere konkrete und auf eure Situation angepasst Impulse erarbeite ich gerne mit dir bzw. euch im direkten Dialog.
Statt sich allein auf die hier gezeigten Ansätze zu verlassen, lohnt es sich erfahrungsgemäß für 95% aller Unternehmen extrem, tiefer in die Materie einzusteigen. Die beste Analyse als Startpunkt für eine ggf. notwendige Weiterentwicklung ist im, bis 30.06. im Rahmen einer Kooperation mit AGILITYINSIGHTS extrem preiswert verfügbaren „Krisen-Resilenz“ Paket enthalten. Sie beinhaltet eine umfassende und tiefgehende Diagnose des Status Quo in vielen der angesprochenen Bereiche, sowie Mentoring Workshops zur Diskussion der Lösungsansätze. Auch hierzu gerne mehr auf Anfrage per PN oder mail.
Wer sich zu den Top-Executives eines Unternehmens zählen darf, dem hilft es, sich intensiver mit dem aktuellen und alternativ mit zeitgemäßen bzw. zukunftsgewandten Managementmodellen zu beschäftigen. Sie bilden, zusammen mit dem Geschäftsmodell, die eigentliche Basis für Kultur, Leistungsbefähigung und Produktivität und sind damit unverzichtbarer Hebel, wenn es darum geht, Leistung im Unternehmen neuen Raum zu geben. Gemeinsam mit zwei Schweizer Kollegen, Raymond Hofmann und Lukas Michelhaben wir zur notwendigen Komplettierung der Gesamtsicht den Managementmodell Canvas entwickelt. Mehr zu diesem Thema gerne auf Anfrage.
Noch ein Hinweis für die Führungskräfte unter euch. Gerade in der aktuellen Situation gibt es viele konkrete Themen und Aufgabenstellungen, bei denen sich viele alleingelassen fühlen. Zusammen mit meinen freiKopfler Kollegen Heiko Bartlog und Christoph Karstenhaben wir ein Dialogformat aufgesetzt, dass es Führungskräfte ermöglicht in einem geschützten Raum miteinander in den Austausch zu aktuellen Themenstellungen zu kommen. Die nächste Gelegenheit dieses Format kostenfrei zu nutzen ist unser Angebot im Rahmen des Digitaltags 2020. Den Link zur Anmeldung findest du hier (Eventbrite).
18.05.20 | Allgemein, Blog, Leadership / Führung, Management, Wirksamkeit, Zusammenarbeit |
Gute Führung ist Bewusstsein und Raum für
- Ideen
- Entscheidungen und Lernchancen
- neuen Optionen und Risiken
- Probleme und Lösungen
- Stress und Entspannung
- Ängste
- Werte
- Druck und innere & äußere Resilienz
- Systeme, Systemiken und dem, dass wir (noch) nicht verstehen können
- Netzwerke und Partner
- Visionen, Ziele und Strategien
- Strukturen und Prozesse
- Macht und Ohnmacht
- Stärken und Schwächen
- Fair- und Unfairness
- Wissen und Information
- Ressourcen und Ballast
- Optimales und Suboptimales
- Nachrichten und Kommunikation
- Offenheit
- Beteiligung
- Stimmungen und Gefühlen
- Kenntnissen und Erkenntnissen über sich und andere
- nachhaltig positive Wirkung auf das Unternehmen und die Menschen (darin und darüber hinaus)
Es ist Vertrauen, Ehrlichkeit, Verbundenheit, Verletzlichkeit. Es sind große Ziele und kleine Gesten, gemeinsame Rituale und starke Verbindungen.
Gute Führung ist eine große, herausfordernde Aufgabe, die man gemeinsam leichter erreicht. Gute Führung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Heute mehr denn je.
Eigentümer und Unternehmen müssen die Freiheiten einräumen. TopManager müssen den Rahmen definieren. Führungskräfte müssen sie leben. Mitarbeiter können sie durch ihr Feedback mitgestalten.
Nur so können alle daran und darin wachsen – zum Wohle jedes einzelnen, zum Wohle aller.
Ein Bewusstsein für den Wert guter Führung zu schaffen ist für diejenigen unmöglich, die kein Bild von ihr haben, die nie erleben durften, wie befreiend und bestärkend es ist die Menge an Raum vorzufinden, die soviel Sicherheit gibt, dass sie befähigt die eigenen Grenzen zu überwinden. Raum für den Raum zu haben ist ein wichtiges Kulturmerkmal. Enge ist es auch – sie macht Unternehmens-Unkultur sichtbar.
Auf Kultur und Führung kann man Einfluss nehmen, aber man kann sie nur indirekt beeinflussen. Die eine nicht, weil sie von vielen Menschen gemeinsam gestaltet wird, die andere nicht, weil sie von vielen anderen verantwortet und manchmal unverantwortet wird.
Die Arbeit an beidem braucht den Wunsch und die Offenheit vieler, der Zusammenarbeit im Unternehmen eine positivere Zukunft zu geben. Dann kann man neue Rahmenbedingungen gestalten und vereinbaren, dann kann man ein neues Fundament und Betriebssystem schaffen. Damit verändert man den kulturellen Quellcode des Unternehmens.
Gute Führung ist Bewusstsein und Raum aller! Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, JETZT!
25.03.20 | Blog, Leadership / Führung, Management, Nachhaltigkeit, Organisationsgestaltung, Zusammenarbeit |
>>> Impuls, Reflexionsfragen & Tipps
Der Coron-Virus und Covid-19 wird uns sehr nachhaltig im Griff halten. Das ergibt sich allein schon aus einer groben Sicht auf die Zahlen. Aber was heißt das kurz- mittel und langfristig? Was sollten Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter jetzt und in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren tun, um die Zeit möglichst unbeschadet zu überstehen und danach eine möglichst gute Ausgangsposition zu besitzen?
Es werden derzeit viele Szenarien und (teilweise) Utopien diskutiert. Vieles dreht sich dabei auch um die Frage: Was sind Menschenleben wert, denn, am Ende hängt das aktuelle Geschehen in unserer Gesellschaft davon ab, wie wichtig uns unser wirtschaftliches Wohlergehen (und da sind wir weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau unterwegs) im Vergleich zum Wohlergehen und Überleben, vor allem der älteren und vorerkrankten Verwandten, Freunde und Mitmenschen ist. Schon jetzt werden Stimmen in einigen Ländern laut die, vereinfacht sagen: Lasst die Alten sterben, damit es den Jüngeren gut geht.
Aber, das nur am Rande, denn bei den Unternehmen geht es nicht darum, ob sie jung oder alt sind, es geht darum, wie sie grundsätzlich überleben und die Krise bewältigen können. Dabei haben es die kleinen und mittleren (wieder mal) schwerer, weil es für sie, unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung, oft schwieriger ist, Unterstützung zu erhalten, um z.B. die Liquidität sicherzustellen, wichtige Ressourcen zu beschaffen oder die Kosten kurzfristig zu senken. Hier soll das Rettungspaket des Bundes und der Länder helfen, aber allein wird es kaum mittel- und langfristig helfen. Doch was kann und sollte man darüber hinaus tun? Was kann man jetzt schon starten, um im weiteren Verlauf der Krise eine möglichst stabiles und sicheres Fundament unter den Füßen zu haben?
Wenn man in den letzten zwei Wochen durch die Social Media Welt surft, dann dominiert das Thema Home Office die Kommunikation. Es scheint als hätte jeder seine Top-Tipps ins Netz gestellt. Das ist kurzfristig richtig und wichtig und auch ich habe ein paar Hinweise aus meinem Fundus beigesteuert, aber je länger wir mit den aktuellen Einschränkungen leben, desto wichtiger wird es in die Zukunft zu denken. Denn, auch falls der weitgehende Lockdown in ein paar Wochen aufgehoben wird, bis wir wieder so etwas wie Normalität im Arbeitsleben erleben, wird es noch viele Monate dauern. Auch nach dem Lockdown wird der Virus solange unser Begleiter sein, bis ausreichend Medikamente und Impfstoffe verfügbar sind und die „Durchseuchung“ weit genug fortgeschritten ist. Solange werden wir in vielen Bereichen auf Abstand bleiben, auch, um nicht doch ganze Unternehmen kurzfristig lahm zu legen. Denn auch wenn (bislang) 80% der Krankheitsverläufe größtenteils harmlos sind, 14% der Erkrankten brauchen Beatmung und 5% der Verläufe sind kritisch, u.a. weil ein Atemstillstand auftritt ist. Das trifft zwar bislang vor allem Ältere, aber auch bei den Patienten zwischen 20 und 50 Jahren gibt es solche kritischen Verläufe. Für ein Unternehmen mit 50 MA tauchen, schon rein statistisch, auch schwere Fälle in der Belegschaft auf und 170 durch Covid-19 bedingte zusätzliche Krankheitstage sind wahrscheinlich. 170 Tage, die die Produktivität und Arbeit in den nächsten 12 Monaten weiter bremsen. Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter bekommt einen neuen Stellenwert und neue Gesichtpunkte.
Die weiteren absehbaren Folgen
In Krisenzeiten ist Effektivität (noch) wichtiger als Effizienz. Statt Quartalsziele anzustreben, geht es um langfristige Wirkung, statt um maximale Kostensenkung geht es um minimalen Aufwand mit maximalem Effekt, auch (und manchmal vor allem) bei Abläufen, in den Strukturen, der Kommunikation und bei Entscheidungen.
Mit Blick auf die mittel- und langfristigen Folgen stellt sich die Frage, was sich jetzt bewährt und die Wirkung der notwendigerweise eingesetzten Ressourcen erhöht hat. An vielen Stellen muss mit weniger Ressourcen mehr geleistet werden. Das erfordert den größten Wandel der Basisparameter von Management und Organisationsgestaltung seit den 1970’er Jahren.
Die konkreten und aktuellen Folgen der Krise sind vielfältig, neben Umsatzeinbußen wegen ausbleibenden Kunden, fehlender Produktionskapazität und verlangsamter (Neu)Entwicklung durch eine veränderte Interaktion der Mitarbeiter kommen mittelfristige Effekte hinzu. Mitarbeiter haben plötzlich in Bezug auf den Arbeitsort, die Arbeitszeit und ihre Entscheidungskompetenzen neue Freiheiten, Prozesse und Strukturen müssen den veränderten äußeren Rahmenbedingungen angepasst werden. Gleichzeitig steigt der Krankenstand und langfristig trauen sich immer weniger Mitarbeiter mit leichten Krankheitssymptomen (einer Erkältung oder Grippe) ins Unternehmen. Es stellt sich also die Frage, was es braucht, welche neue Ansätze und welche Art von Flexibilität benötigt wird, um die Mitarbeiter weiterhin in den Arbeitsprozess einbinden zu können und den Krankenstand nicht indirekt und zusätzlich zu erhöhen. Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter bekommt einen neuen Stellenwert.
Weitreichendere Folgen werden wir ebenso an vielen Stellen spüren. Covid-19 wird ebenso wie Menschen auch Unternehmen „töten“. Mitarbeiter werden sich neue Arbeitsplätze suchen müssen und viele Unternehmen neue Lieferanten und Geschäftspartner. Die Erfahrung der Krise wird zu einer verstärkten Modularität, Vielfalt und Redundanz in Bezug auf Lieferketten und Partnerschaften führen. Der Aufbau von noch intensiveren Netzwerken ist für Unternehmen, wie ab sofort für (potenziell zukünftig arbeitssuchende) Mitarbeiter enorm wichtig.
Das bedeutet in Zukunft mehr Interaktion bei gleichzeitig (vorerst) mehr Abstand. Wo heute Dienstreisen das Mittel zum Zweck sind, um vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, werden wir vermehrt aus die jetzt intensiver kennengelernte Online-Kommunikation / Webkonferenzen ausweichen, was die Digitalisierung auch in anderen Unternehmensbereichen fördert.
Zugleich wird Präsenz einen neuen Wert erhalten und wir werden anders mit, in dieser Form geteilter Lebenszeit umgehen.
Was ist mittel- und langfristig wirklich wichtig?
Was die Krise deutlich macht: Wichtig um miteinander die aktuellen und kommenden Herausforderungen zu meistern ist vor allem die Wahrnehmung von individueller und gemeinsamer Sicherheit. Gesundheitliche, finanzielle und soziale Sicherheit und Stabilität sind die wichtigsten Elemente, um miteinander in Unternehmen in die Zukunft zu blicken und gehen. Das ist keine neue Erkenntnis, so haben wir Menschen in Krisenzeiten immer funktioniert. Aber nach dem jahrzehntelangen wirtschaftlichen Aufschwung, ist vieles, was gute (Unternehmen)führung ausmacht, stark in Vergessenheit geraten. Es wird Zeit dieses alte Wissen neu zu nutzen!
Es ist wichtig, JETZT die richtigen Schritte einzuleiten! Welche Zielsetzung ist jetzt für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter jetzt wichtig? Es geht zunächst mehr um die kleinen als die großen Ziele, aber beides muss harmonieren und aufeinander aufbauen. Allerdings verändert die Krise auch die Qualität, den Inhalt und die Tragkraft von Zielen. Zunächst ist es wichtig, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um mit dem in den nächsten Monaten erwartbaren umzugehen. Ganz pragmatisch, ohne Firlefanz und groß gesteckte Wachstumsziele. Es geht darum ein stabiles Fundament zu finden. Einfach nur das. Nichts mehr.
Doch Sicherheit hat zwei Aspekte: Kontrolle und Handlungs(frei)raum. Die einen (Mitarbeiter, Führungskräfte und Unternehmen) fühlen sich wohl, wenn sie wissen, dass ein sinnvolles Maß an Kontrolle herrscht, wenn klar ist, was kommt, was zu tun ist und welche Folgen dies hat – in Krisenzeiten ist dies für viele um so wichtiger – andere brauchen Handlungsspielraum, um sich nicht in Dinge und Lösungen hineingedrängt zu fühlen, die ihnen nicht entsprechen. Mehr denn je ist es damit jetzt eine wichtige Führungsaufgabe, dies zu erkennen und mit den unterschiedlichen Mitarbeitern und Teams entsprechend umzugehen. Individuelle und situative Führung (auf Distanz) hat jetzt einen ganz besonders hohen Stellenwert!
Wenn die einen rufen, dass Agilität die Lösung für die Herausforderungen ist, so haben sie Recht, aber sie bringen damit andere zusätzlich in die Überforderung. Wenn andere rufen, dass klare Anweisungen jetzt das Mittel der Stunde sind, so führt dies ebenso zu Ablehnung und Widerstand. Ein gesundes Mittelmaß ist nicht leicht zu finden, aber (auch) von besonderer Bedeutung!
Wie findet man jetzt den besten Weg?
Wenn das kurzfristige Überleben sichergestellt ist, sollte einer der ersten Schritte einen zukunftsgerichteten Unternehmensführung sein, die verschiedenen Szenarien der weiteren Entwicklung durchzudenken. Wie hat sich das Verhalten der Kunden und Märkte ggf. verändert? Welcher Bedarf besteht für die eigenen Angebote, jetzt, während und nach der Krise? Welche mittelfristigen Zielsetzungen sind realistisch und wie sieht die Strategie aus, diese zu erreichen? Hier, auch das ist nicht neu, sollten jetzt umso dringlicher als bisher, die Mitarbeiter intensiv mit einbezogen werden. Denn sie haben (auch) die Veränderungen in der Krise erlebt, sie kennen die Märkte und Möglichkeiten, und sie haben in den letzten Wochen wahrscheinlich neue Erfahrungen gesammelt, die bedeutsam sein könnten.
Die zweite Frage ist, wie diese Ziele erreicht werden können. Auch hier sind die neuen Erfahrungen relevant. Jedes Unternehmen funktioniert nach seinem eigenen, aus Kultur, der Zielsetzung und den Strukturen und Prozessen zusammengeschmiedeten Betriebssystem. Es definiert die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit und bringt explizite und implizite Verhaltens- und Handlungsweisen mit sich. Die Frage, die sich viele Unternehmen, in denen es auch vor der Krise schon knirschte und knackte, jetzt um so dringlicher stellen sollten, ist: Ist unser Betriebssystem geeignet, mit den aktuellen und kommenden und wahrscheinlich in dieser Form neuen Herausforderungen bestmöglich umzugehen? Welche Optionen und Alternativen gibt es, die uns jetzt mehr Möglichkeiten, Sicherheiten und Stabilität bieten? Hat sich die Art, wie miteinander gearbeitet wird verändert? Was davon bietet auch zukünftig Vorteile, was Nachteile?
Dies sind Fragestellungen, für die bislang auch die klügsten und fortschrittlichsten Unternehmensführer zu wenig Zeit hatten. Sie sind jetzt dennoch wichtiger denn je, denn an den alten Mustern festzuhalten kann, bzw. wird sich in vielen Fällen als fatal erweisen. Die neuen Muster und Gewohnheiten zurückzudrehen, insbesondere, wenn sie jetzt über mehr als 3 – 4 Wochen angewendet werden (müssen), kann sonst später für viel Wirbel und Unmut sorgen.
3 Tipps um Klarheit zu gewinnen:
- Beantwortet die Reflexionsfragen (s.o.)
- Macht euch bewusst, auf welchem Fundament euer Betriebssystem aufbaut. Betrachtet dazu das etablierte Menschenbild und das genutzte Managementmodell (meine Toolempfehlung: managementmodeldesign.net).
- Führt eine Statusanalyse der im aktuellen Betriebssystem befindlichen Potenziale und Hemmnisse durch (Meine Toolempfehlung: Agile Scan (siehe: „Free Agile Scan„)
Der Unterschied zwischen der Arbeit vor der Krise und der Arbeit in der Krise wird an den Prozessen und Strukturen am augenscheinlichsten, die schnell „geopfert“ werden konnten. Welche Statusreports und Projektberichte werden zurzeit noch geschrieben und welchen echten Wert haben sie? Welche Meetings konnten ausfallen oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden? Welche Entscheidungen wurden jetzt auf anderen Wegen getroffen?
All dies sind Indikatoren, für ungesunde Gewohnheiten und Muster, die sich tief in das gelebte Management- und Organisationsverhalten eingeschlichen haben. All das sind Indikatoren für die Bereiche, die jetzt, als quasi positive Folge der Krise, genauer betrachtet, analysiert und dann sinnvoll verändert und angepasst werden können. All das sind Ansatzpunkte für eine Runde „ausmisten“, eine bewusste Analyse der mehr und weniger hilfreichen Prozesse, Projekte und Strukturen.
Als Führungskraft in der Krise lernen
Das betrifft Organisationen genauso, wie auch individuelle Führungsgewohnheiten. An welchen Stellen hat sich die Art, wie geführt wird und Führung wahrgenommen wird verändert? Was ist leichter und einfacher geworden, was ist schwieriger? Wer hat Führungs- und Entscheidungsaufgaben übernommen, wer kam damit zurecht, wer hatte seine Probleme?
Führungskräftecoaching kann jetzt, trotz Unwägbarkeiten, hier schnelle und zielgerichtete Unterstützung bedeuten. (Toolempfehlung: Als Basis für ein Coaching gibt es ein brandneues Angebot von AgilityInsights: „MyFlowScan“)
Aus Führungssicht ist „loslassen“ an vielen Stellen ein kaum verzichtbarer Ansatz. Sei es, weil die Arbeit plötzlich an 10 oder 20 unterschiedlichen Orten stattfindet, sei es, weil die Folgen nicht mehr abseh- und planbar sind. Wer weiß schon, wie unser Arbeitsleben nach Ostern aussehen wird oder im Mai oder nach dem Sommer? Wo nichts mehr planbar ist, ist es wie gesagt wichtig, den Rahmen, das Betriebssystem zu kennen, in dem sich Dinge entwickeln können, sollen und dürfen. Das betrifft formale Rahmen genauso, wie finanzielle und sozial. Doch innerhalb dieses Rahmens ist dann loslassen die einzige Option, die es erlaubt weiterzugehen. Weder der Blick zurück, noch der Blick nach vorne liefert Gewissheit für das was kommen kann.
Krisenzeiten sind Zeiten, in denen sich Mut und Zusammenhalt (meist) besonders positiv auswirken. Als Führungskraft bedeutet das, den Mut zu haben, den „powerful people“, den Menschen, die es mit in der Hand haben, die Zukunft aktiv und positiv mitzugestalten, Raum zu geben. Offen und transparent. Sie sind die Mitarbeiter und Kollegen, die 80% der neuen Bewegung ausmachen. Sie sind es die in kleinen Teams zusammengebracht werden sollten, die freien agierten und entscheiden können sollten.
Fazit
Wie in Unternehmen (zusammen)gearbeitet wird, unterscheidet sich zum Teil stark von dem, was vor 3 Wochen der Normalzustand war. Nach der Eingewöhnungsphase, für die wir ja noch mindestens knapp zwei Wochen Zeit haben, werden die ein paar Wehwehchen aufgespürt und die ersten Probleme gelöst sein. Es werden sich neue Prozesse, Handlungs- und Kommunikationsmuster etablieren. Muster, die teilweise auch weiterhin richtungsweisend sein werden.
Doch, um nach der Krise nicht in eine neue zu rutschen, sollte jetzt damit begonnen werden, bewusst die Folgen und Konsequenzen zu betrachten und zu schauen, ob die Art der Zusammenarbeit, nach all dem Erlebten und neue gelernten, nicht eine andere sein kann und sollte. Es ist jetzt Zeit das Betriebssystem einer genauen Prüfung zu unterziehen, um sicher und gestärkt aus der Krise hervorzugehen.
Auch mein Geschäft läuft derzeit „anders“ als zuvor. Alle „on-site“ Termine, Vorträge und Workshops sind abgesagt. Aber die meisten meiner Angebote funktionieren auch online, insbesondere das Mentoring, Coaching und alle Arten von tiefergehenden Analysen.
Um meine Kunden nicht noch mehr zu belasten, ihnen aber dennoch die Chance zu geben, jetzt an den Dingen zu arbeiten, biete ich an einen Teil der Investition für einen gemeinsam vereinbarten Zeitraum zu stunden. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund zu warten.
17.03.20 | Blog, Leadership / Führung, Management, Zusammenarbeit |
>>>> Impuls
Wir befinden uns urplötzlich und nicht selbst verschuldet in der Krise – alle, gemeinsam und mittendrin statt nur dabei. Um die Zeit möglichst unbeschadet zu überstehen, kann es helfen, ein paar Impulse (mehr als sonst) zu berücksichtigen. In diesem Sinne werde ich in dieser Zeit vermehrt kurze Dankanstöße anbieten.
VW-Konzernchef Herbert Diess sagte zur aktuellen Entwicklung: „Durch die Bündelung unserer Kräfte, eine enge Zusammenarbeit und gute Moral im Konzern wird es uns gelingen, die Corona-Krise zu bewältigen.“ Dagegen gibt es grundsätzlich nichts zu sagen. Allerdings habe ich aufgrund eigener Erfahrungen, bestätigt durch viele Kollegen ein anderes Bild von VW, das sich aber leider 1zu1 auf viele Unternehmen und deren Führungen übertragen lässt. Der Confirmation-Bias schlägt zu. Viele GeschäftsführerInnen und Vorstände neigen dazu, die Situation im eigenen Unternehmen „gnadenlos“ überzubewerten.
Eine zu wenig objektive Sicht auf die Fähigkeiten und den Gesamtzustand des Unternehmens zu haben, rächt sich besonders in Krisenzeiten, da das Fundament fehlt, um die zusätzliche Belastung auszuhalten.
Wer jetzt klug handeln möchte, sollte sich zunächst ein möglichst objektives Bild von der tatsächlichen Situation im Unternehmen verschaffen, also wie ist die Stimmung, welche Potenziale werden genutzt, welche Hindernisse müssen gerade jetzt beseitigt werden, wie gut funktioniert die Kommunikation von Zielen und Strategien, wie werden die Führungsinstrumente genutzt. Das alles kann man (auch Online) leicht evaluieren – es gab nie einen besseren und richtigeren Zeitpunkt als heute, um dies zu tun! (Mehr Infos gerne auf Anfrage.)
In der Zeit der Krise sind Rituale und Routinen von besonderer Bedeutung! Wichtig sind (gerade jetzt) klassische Grundtugenden, wie
- Ruhe bewahren und Resilienz aufbauen,
- Sicherheit vermitteln,
- Achtsamkeit und Vertrauen verstärken,
- Bewusst und transparent handeln.
Führungskräfte haben jetzt die besondere Verantwortung, die Weichen richtig zu stellen und die Grundtugenden vorzuleben und zu vermitteln. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Verbindlichkeit sind von enormer Bedeutung! Vertrauen in der Verantwortungsübernahme und -übergabe zahlt sich extrem aus. Zugleich ist die Informationsflut derzeit riesig und verwirrend. Achtet also darauf die wichtigsten Informationen gezielt und einfach verständlich zu verbreiten.
Doch Fehlmeldungen und noch mehr Fehlinterpretationen der eigenen Situation sind an dieser Stelle fatal und werden von den Mitarbeitern extrem kritisch wahrgenommen.
Take good care!
In den nächsten Wochen biete ich kostenfreie, offene Online (Sprech)Stunden an, jeweils Dienstags zwischen 10:00 und 11:00 sowie Donnerstags zwischen 15:00 und 16:00. Mehr Infos auf Anfrage gerne per mail oder PN.